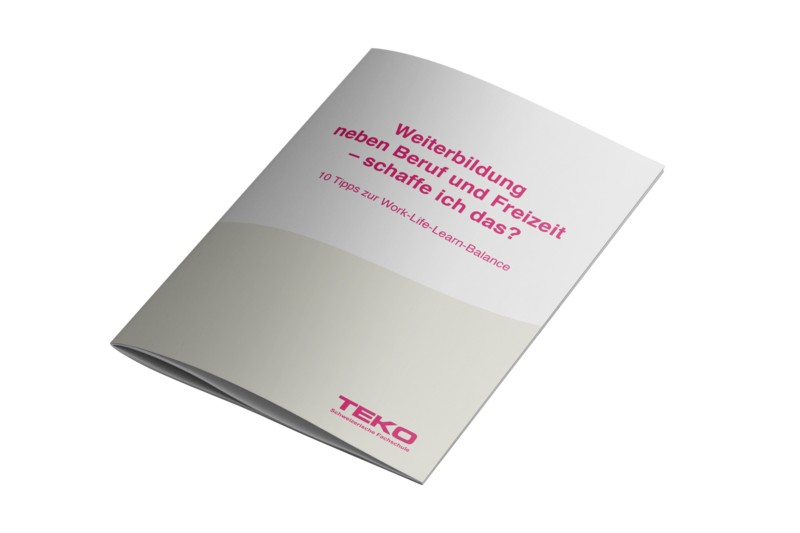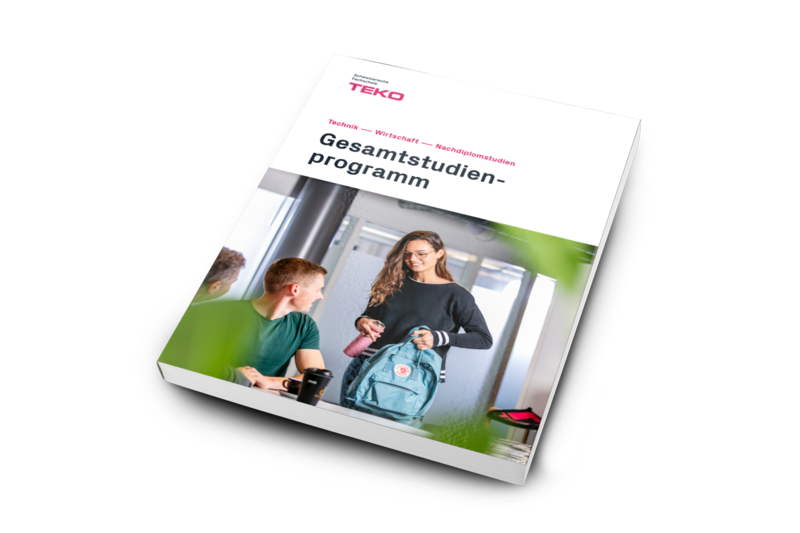Ausgangslage
Als ich vor 15 Jahren bei der Heinz Burkhalter AG angefangen habe gab es nach einiger Zeit ein neues Standardprodukt, die Omnia-Steuerung. Die Steuerung wurde damals von einer externen Firma entwickelt. Sie sollte zum einen neue Technologien unterstützen aber gleichzeitig auch kompatibel mit der Vorgängersteuerung sein. Dies führte dazu, dass die Steuerung sehr viele Optionen hatte, die kaum genutzt wurden.
Die Software lies sich aber nur umständlich anpassen, da Sie nicht von uns stammt. Die Steuerung musste bei einem Defekt oft komplett ausgetauscht werden.
Daraus entstand der Auftrag für meine Diplomarbeit. Ich sollte mit einer neuen SPS und neuem HMI die Omnia 2 programmieren und visualisieren. Die Steuerung soll nur für neue Anlagen ausgelegt werden, alle veralteten Optionen werden gestrichen. Das Programm soll für alle Programmierer in der Firma nachvollziehbar sein und Änderungen können leicht vorgenommen werden. Dadurch, dass die Visualisierung an die Grossprojekte angelehnt ist, soll die Bedienung für die Techniker vertraut, einfach und intuitiv sein.
Vorgehen
Die Erarbeitung wurde in mehrere Teile aufgeteilt.
Grundlagen
In einem ersten Schritt habe ich die Designs der einzelnen Elemente erstellt wie z.B. die Messwertanzeigen, Buttons und die Zeichnung der Anlage. Wenn man diese Elemente erstellt hat kann man nach dem Baukastenprinzip den Rest der Visualisierung erstellen. Damit ich alles simulieren konnte benötigte ich auch ein funktionierendes Programm. Funktionsbausteine und Programmstrukturen wurden erstellt, die Alarmierungen und die Schrittkette.
Testen, Ergänzen,...
Die beiden Programme wurden danach unfertig auf die Hardware geladen und mittels Schalter und Simulatoren getestet. Alle Funktionen wurden nach und nach geprüft, korrigiert und laufend ergänzt, bis das Ergebnis betriebsbereit war. Anschliessend wurde die Steuerung auf die Testanlage montiert und von Servicetechnikern geprüft.
Nachweis der Erfolgskriterien
Zum Nachweis das die Steuerung gemäss den Vorgaben alle Funktionen erfüllt habe ich Prüfprotokolle erstellt in welchen z.B. die Alarme und ihre Funktionen erfasst wurden.
Ergebnis
Dadurch, dass ich bereits in der dritten Woche mit der Software fertig war hatte ich ganze drei Wochen Zeit, um die Anlage auf Herz und Nieren zu prüfen und alle entdeckten Fehler zu beheben. Die Anlage wurde von Servicetechnikern wie auch dem Fachbetreuer intensiv geprüft.
Zusätzlich dazu habe ich noch Funktionen zu implementieren, welche aus der Diplomarbeit ausgegrenzt wurden und konnte dadurch das Projekt vollständig abschliessen.
Das Ergebnis ist eine Steuerung, die alle Vorgaben erfüllt.
Nun kann die Steuerung in Serie produziert und an den Kunden ausgeliefert werden.
Funktionsbeschreibung der Umkehrosmoseanlage
Das Eingangsventil der Anlage geht auf und die Permeatoren (Edelstahlrohre im Hintergrund, Bild Testanlage) werden mit Leitungsdruck gespült. Dasselbe geschieht im Anschluss nochmals, aber dieses mal mit eingeschalteter Druckpumpe, bis die Leitfähigkeit des Wassers den gewünschten Grenzwert unterschreitet. Das Wasser wird danach in den Tank produziert und über die Druckpumpen (hinten rechts, Bild Testanlage) an den Kunden weitergeben.
In den Permeatoren findet die Umkehrosmose statt und wie dieser Prozess funktioniert lässt sich mit einem Auszug aus der Firmenwebseite erklären.
Osmose in der Natur
Ein anschauliches Beispiel ist das Aufplatzen reifer Kirschen im Regen. Zwei wässrige Lösungen haben immer das Streben danach, sich zu vermischen und ihre Konzentration somit auszugleichen. Das Regenwasser auf der Aussenseite der Kirsche hat viel weniger Zucker und andere Stoffe gelöst als das Wasser innerhalb der Kirsche. Es wird also Wasser in die Kirsche hineinfliessen, bis es innen und aussen dieselbe Konzentration hat. Da die Haut der Kirsche aber nur Wasser durchlässt und keinen Zucker ist dies nicht möglich und es baut sich ein osmotischer Druck auf, bis die Haut platzt.
Umkehrosmose: Osmose rückwärts gedacht
Bei der Umkehrosmose wird der Prozess der Osmose umgekehrt, indem auf der Seite der höheren Konzentration ein Druck aufgebaut wird. Für eine Kirsche würde dies bedeuten, dass Wasser aus der Kirsche rausgepresst würde, bis nur noch hochkonzentrierter Saft in der Haut zurückbleibt.
In der Praxis wird bei der Umkehrosmose das zu behandelnde Wasser mit Druck durch eine halbdurchlässige Membran gepresst. So werden praktisch alle gelösten Stoffe im sogenannten Konzentrat zurückgehalten und das reine Permeat wird gewonnen.
(Quelle: Heinz Burkhalter AG)