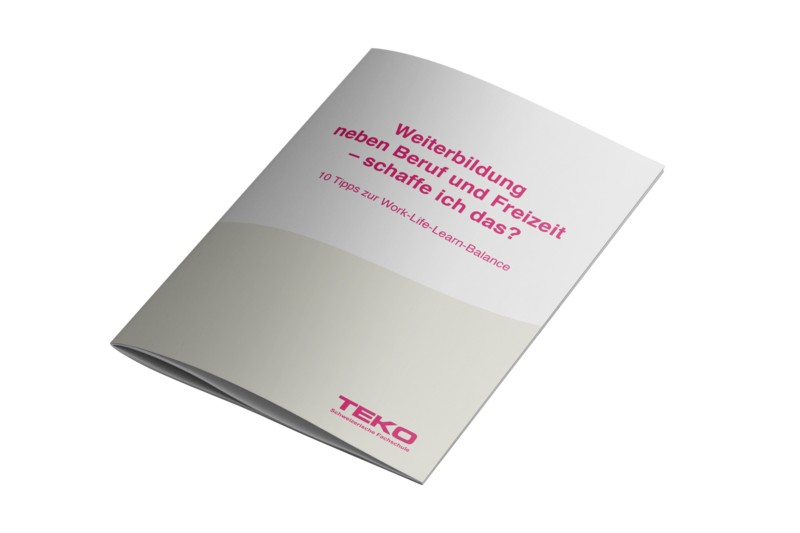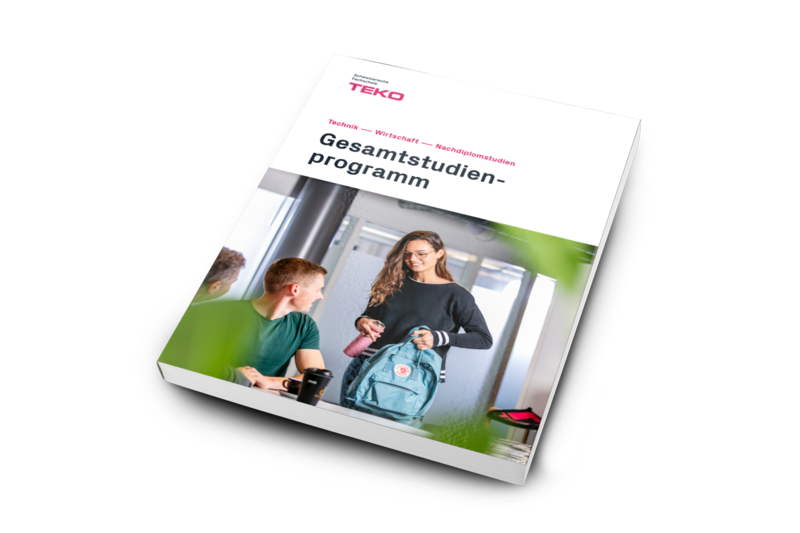Management Summary
Zum Studiengang Diplomierter Techniker HF Elektrotechnik gehört es dazu, dass zum Ende des Studiengangs eine Diplomarbeit geschrieben wird. Für das Projektteam, bestehend aus den Teammitgliedern Simon Ehrenmann und Marc Blum, ist schon von Anfang an klar, dass es diese Diplomarbeit zusammen bewältigen möchte. Schon früh wird damit begonnen, sich mögliche Projekte zu überlegen. Das Projektteam landet jedoch immer wieder bei der Idee, ein Messgerät zu entwickeln, welches Messwerte verschiedenster Umwelteinflüsse erhebt und diese auf einem Display anzeigt. Also fällt der Entscheid das «LEMS» zu bauen. Das LEMS soll die Messwerte zur Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und des CO₂ erheben. So die Ausgangslage. In der Dokumentation wird klar, dass sich dies um einige Funktionen und Komponenten erweitert hat.
Zu Beginn der Initialisierungs- und Planungsphase wird die Zielsetzung, unter Hilfenahme des Antrags, definiert, das Pflichtenheft erstellt und die Projektorganisation gemacht. Mit diesen Informationen begibt sich das Team in die Konzeptionierung des LEMS. In dieser fallen weitreichende Entscheidungen. Fehler, oder nicht berücksichtigte Punkte, die in dieser Phase gemacht werden, ziehen sich durch das gesamte Projekt und sind nur durch erhöhten Aufwand in den späteren Phasen auszumerzen. Somit empfiehlt es sich, hier besondere Sorgfalt walten zu lassen. Gesagt, getan. Es wird ein erheblicher Aufwand betrieben, um nicht Gefahr zu laufen, dass es später zu erheblichen Problemen kommt.
Dies bewährt sich in der Realisierungsphase. Jedes Teammitglied weiss, was es zu tun hat und führt seine Schritte akribisch aus. Jedoch wird die meiste Arbeit gemeinsam erledigt. Dies bietet mehrere Vor- aber auch Nachteile. Ein unbestreitbarer Vorteil ist, und von dem hat man profitiert, dass jedes Teammitglied vollumfänglich über das Projekt Bescheid weiss und es somit kaum Koordinationssitzungen benötigt. Ein Nachteil der entsteht ist jedoch, dass es einen massiven zeitlichen Aufwand bedeutet. Während bei einer aufgeteilten Arbeitsweise fast doppelt so viel erledigt werden kann, wird beim gemeinsamen Arbeiten viel weniger Output generiert. Durch diese Arbeitsweise kann meist eine höhere Qualität erreicht werden und dies schreibt sich das Projektteam auf die Fahnen. Qualität braucht aber auch seine Zeit. Auch in der Realisierungsphase ist der Projektfortschritt, der Planung entsprechend langsam, aber stetig und mit der gewünschten Qualität. Es werden die Komponenten eruiert, sowie die Leiterplatte designt und bestellt. Weiter wird dasselbe mit den Gehäusen gemacht. Hier steckt auch der Knackpunkt: die Beschaffung. Es kann noch so akribisch geplant und konzipiert sein, wenn die Beschaffung nicht gut läuft, wird es gegen das Ende hin knapp. So auch beim Projekt LEMS. Alle Komponenten, ausser dem Gehäuse, werden ordnungsgemäss zugestellt. Das Gehäuse des LEMS wurde leider in einem falschen Finish geliefert. Es wurde schwarz beschichtet, anstatt des bestellten Eloxal-Verfahrens. Das richtig fabrizierte Produkt wurde erst drei Tage vor Ablauf der Abgabefrist geliefert, was das Projektteam am Ende noch als einziges beschäftigt. Dies zeigt die Wichtigkeit der Auswahl des Herstellers, dessen Herkunft (Lieferweg und -zeit) und die frühzeitige Bestellung der Komponenten. Auch wenn alles mit einem grosszügigen Puffer geplant ist, kann man die Aktionen Dritter nur schwer beeinflussen. So auch betreffend die Anfrage zur Werte-Verifizierung bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA und anderen Prüflaboren. Leider bekam das Projektteam von sämtlichen angefragten Prüfstätten eine Absage. Was aber nicht bedeutet, dass es sich damit begnügt. Es setzte alle Hebel in Bewegung, um die Werte zu überprüfen und in den meisten Fällen gelang dies auch. Es wurden Überprüfungsverfahren entwickelt und durchgeführt. Dies mit dem Ziel, die Messwerte so gut als möglich zu verifizieren. Dies bedeutet einen massiven Mehraufwand, welchem sich das Projektteam, auch aus hohem Interesse der Sache gegenüber, mit Freuden stellte. Abschliessend zur Realisierungsphase kann gesagt werden, dass alle vom Projektteam abhängigen Schritte einwandfrei funktioniert haben und die Arbeit, vor allem die gemeinsame, viel Spass gemacht hat.
In der Abschlussphase, insbesondere im Soll-/Ist-Abgleich, wird deutlich, wie sauber man gearbeitet hat. Hier wird sichtbar, ob man die Ziele erreicht oder, wie im Fall des Projektes LEMS, sogar übertroffen hat.
Das Projektteam hat alle geforderten Punkte in hoher Qualität erledigt und den Funktionsumfang des LEMS massiv erweitert. Es ist von einem einfachen Gerät, dass die Werte der Umwelteinflüsse aufnimmt und anzeigt, zu einem Gerät geworden, dass noch viel mehr kann. Angefangen bei den Erweiterungen, über die Einstellungsmöglichkeiten, die Alarme bis hin zum selbst designten Gehäuse. Ein vollumfängliches Produkt.
Konzept
Für das LEMS wurde eine Leiterplatte konzipiert. Dieses wurde auf Basis des Schemas und dem dazugehörigen PCB-Layouts erstellt. Zusätzlich hat man noch zwei Gehäuse dafür entworfen. Zum einen ist dies das Gehäuse für die Leiterplatte des LEMS, bei welchem auch das Display angebracht wird. Zum anderen ist dies das Abschirmgehäuse für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Weiter wurde auch ein Logo erstellt, welches auf dem Display angezeigt aber auch auf der Rückseite des LEMS-Gehäuses eingefräst wird.
Anforderungen
Funktionale Anforderungen
Es sollen folgende Messwerte erhoben werden:
- Temperatur mit einer Genauigkeit von +/- 0.1 °C
- Luftfeuchtigkeit mit einer Genauigkeit von +/- 2 %
- CO2 mit einer Genauigkeit von +/- 5 %
Weiter funktionale Anforderungen sind:
- Alle Werte sollen auf einem LCD-Touch-Display in Farbe angezeigt werden.
- Das LEMS soll, nach dem Einschalten, in unter einer Minute betriebsbereit sein und alle Werte eingependelt und akkurat anzeigen.
- Die erhobenen Messwerte sollen gespeichert werden können.
Nicht-funktionale Anforderungen
- Das LEMS soll angenehm in der Hand liegen und eine einhändige Bedienung ermöglichen. Dies bedingt eine handliche Grösse und Gewicht.
- Alle Komponenten sollen in einem tragbaren System verbaut werden.
- Der endgültige Preis für das LEMS soll, unter Berücksichtigung einer Massenproduktion, den Wert von 400 CHF nicht überschreiten.
Technische Schnittstellen
Die Schnittstellen sollen möglichst kompatibel evaluiert werden. Dabei soll vor allem auf die I2C Schnittstelle gesetzt werden.
Fazit zu den Anforderungen
Es wurden alle Anforderungen erfüllt und das LEMS wurde durch weitere Funktionen erweitert.
Erweiterungen
NOC/VOC-Sensor
Die Leiterplatte des LEMS verfügt über einen Mischgas-Sensor, für welchen der dazugehörige Code jedoch noch geschrieben werden muss. Dies wird bei heutigen Produkten häufig gesehen. Als Paradebeispiel wird hier die Firma Tesla herangezogen. Diese verbaut in Ihren Fahrzeugen oft gewisse Features, welche mit einem Update aktiviert und somit nachträglich dazugeschaltet werden können. Ähnlich ist dies vom Projektteam bei seinem LEMS der Fall.
Batteriestatus-Erkennung
Das LEMS ist fähig, zu erkennen, ob sich die Batterie in einem kritischen oder gutem Ladezustand befindet. Des Weitern wird auch detektiert, ob das LEMS geladen wird. Dies wird in der oberen linken Ecke des Displays, mittels Ladesymbol und einem Symbol, welches einen kritischen Zustand anzeigt, dargestellt.
Stromsparmodus
Um die Betriebszeit im mobilen Betrieb zu verlängern, wurde ein Stromsparmodus erstellt. Dieser tritt in Kraft, wenn das Display länger als 60 Sekunden nicht mehr betätigt wurde. Der Stromsparmodus bewirkt, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays, in Bezug auf die Helligkeit, massiv heruntergeregelt wird.
Sommer- und Winterzeit-Erkennung
Das LEMS verfügt über die Fähigkeit zu erkennen, wann es automatisch zwischen der Sommer- und Winterzeit umstellen muss. Hierfür wird detektiert, ob der Zeitpunkt erreicht ist und passt die Zeit entsprechend automatisch an.
Datum, Wochentag und Uhrzeit (RTC)
Das LEMS verfügt zusätzlich über die Angaben zum aktuellen Datum, den Wochentag und die Uhrzeit. Die Werte werden vom Baustein RTC (RealTimeClock) bezogen und über den Code auf die gewünschten Angaben berechnet. Die Uhrzeit, das Datum und die Längen- und Breitengrade, wie auch die Referenz GMT, können über die Grundeinstellungen verändert werden.
Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit
Das LEMS wurde noch durch die Anzeige der Sonnenauf- und Sonnenunterganszeit ergänzt. Hinter dieser steckt eine aufwändige Berechnung, welche über den Code, anhand von Datum, GMT, Längen- und Breitengrad, erfolgt.
Sprachen
Das LEMS ist Bilingue. Alle Texte des LEMS können sowohl in Deutsch als auch in Englisch dargestellt werden. Die Einstellung erfolgt über die Grundeinstellungen. Durch Tippen auf die Flagge wird diese geändert und zeigt die aktuell eingestellte Sprache an.
Alarme
Das LEMS verfügt über zwei Alarme. Beide beziehen sich auf den CO₂-Wert. Diese können unabhängig voneinander aktiviert und deaktiviert werden. Der Auslöse-Wert des Alarms «Dein Alarm» kann nach den eigenen Wünschen eingestellt werden. Der Alarm «Roter Alarm» ist fix bei 2000 ppm eingestellt und stellt die Schwelle zur bedenklichen Luftqualität dar.
Höhenversatz
Aus Kalibrierungszwecken, und um somit lokale Hoch- und Tiefdrucklagen ausgleichen zu können, verfügt das LEMS über die Möglichkeit die angezeigte Höhe zu verändern. Diese kann über die Erweiterten Einstellungen verändert und so auf den Standort angepasst werden.
Layout
Das Layout für das LEMS wurde mittels Altium Designer erstellt. Die LEMS-Leiterplatte weist einige Punkte auf, die bei der Gestaltung berücksichtigt werden müssen. Zum einen sind dies die thermischen Eigenschaften. Da ein sehr empfindlicher Temperatur-Sensor verbaut ist, sollte die Leiterplatte am Messpunkt nicht durch erwärmende Komponenten fehlerhafte Messergebnisse verursachen. Der Bereich, der am heissesten wird, ist der Versorgungsteil mit der Lithium-Akkumulatoren-Ladeschaltung. Damit wir einen Gewichtsausgleich haben und zudem eine thermische Sperre, wird der Lithium Akkumulatoren-Halter senkrecht in die Mitte gesetzt. Da der Akkumulator während des Ladevorgangs eine minimale Wärme erzeugt, wurde zudem eine intelligente Aussparung (Cut-Out-Schlitz) unter dem Akkumulator platziert. Dies gewährleistet, dass die entstehende Wärme des Akkumulators nicht direkt über die Leiterplatte zum Sensor gelangt. Somit ergibt sich auf der Leiterplatte eine logische Anordnung, bei der die Sensoren auf der linken Seite und die Ladeelemente sowie Anschlüsse und thermisch unkritische Elemente auf der rechten Seite platziert sind.
Direkt oberhalb der Ladeelektronik wurde der USB-C-Stecker platziert. Da der Stecker nur wenig von der Leiterplatte absteht und wir aufgrund der Grösse des Displays eine vorgegebene Gehäusegrösse haben, müssen wir diesen mit Hilfe eines Ausschnitts um mehrere Millimeter nach außen versetzen.
Direkt neben dem USB-C-Anschluss befindet sich die Lade-LED. Auf diese Weise sieht man sofort, wenn das Ladekabel eingesteckt wurde, ob das Laden beginnt. Der Taster für das Ein- und Ausschalten wurde direkt neben der LED platziert, ähnlich wie bei einem Smartphone, um eine einhändige Bedienung zu ermöglichen. Da das Display ebenfalls Wärme erzeugt, kommt es über das Flachbandkabel zu einer thermischen Verbindung. Das bedeutet, dass das Display Wärme über das Flachbandkabel an unsere LEMS-Leiterplatte abgibt.
Hardware
Komponenten
Für das LEMS bediente man sich, bezüglich der SMD -Komponenten (Surface-Mounted-Device), an den Baugrössen 0402 und 0603. Die THT-Komponenten (Through-Hole-Technology) umfassen lediglich die Batteriehalterung und den Ein-/Ausschaltbutton. Unter die Elektromechanischen Bauteile fallen die Leiterplatte, das 4D-LCD-Display, das Flachbandkabel, welches für die Verbindung von Leiterplatte zum Display verwendet wird, und die SD-Speicherkarte sowie die Batterie des LEMS. Die beiden erstellten Gehäuse fallen unter die Kategorie der Mechanischen Bauteile.
Beschaffung
Sämtliche SMD- und THT-Bauteile wurden über den Hauptlieferanten Digikey bezogen. Bezüglich der Beschaffung der Elektromechanischen Bauteile musste diese auf vier verschiedene Lieferanten aufgeteilt werden. Die Leiterplatte wurde über Elecrow beschafft. Das LCD-Display wurde direkt beim Hersteller 4D-Systems bezogen. Das Flachbandkabel und die SD-Karte konnten jedoch wieder beim Hauptlieferanten Digikey beschafft werden. Für die Beschaffung der Batterie, also dem Akkumulator des LEMS, wurde der Lieferant SwissBatt24 herangezogen.
Kosten
Die Kosten wurden für zwei Fälle erstellt. Deren sind zum einen in Klein-Serie, was einer Auflage von 3 Stück entspricht. Und zum anderen in Gross-Serie, was einer Auflage von 1000 Stück entspricht.
SMD-Komponenten:
Klein-Serie: 72.08 CHF
Gross-Serie: 39.23 CHF
THT-Komponenten:
Klein-Serie: 3.11 CHF
Gross-Serie: 1.74 CHF
Elektromechanische Komponenten:
Klein-Serie: 113.05 CHF
Gross-Serie: 88.14 CHF
Mechanische Komponenten:
Klein-Serie: 59.10 CHF
Gross-Serie: 32.50 CHF
Fazit zur Beschaffung
Für ein vollständiges LEMS, gebaut in einer Klein-Serie von 3 Stück und ungeachtet des Arbeitsaufwandes, werden folgende Herstellungskosten errechnet: 247.34 CHF
Wird das LEMS in einer Gross-Serie, also einer Auflage mit 1000 Stück, produziert, wird folgender Endpreis für die Komponenten errechnet: 161.61 CHF
Zusammenbau
Der Zusammenbau des LEMS erfolgte in den privaten Räumlichkeiten eines Teammitglieds und wurde in mehreren Schritten vollzogen.
- Das Bestreichen der Leiterplatte mittels Lötpaste und Schablone.
- Es werden die SMD-Bauteile auf die dafür vorgesehenen Positionen platziert.
- Die Leiterplatte wird mit den Komponenten in einem Lötofen verlötet.
- Die THT-Komponenten werden manuell angelötet.
- Die Leiterplatte wird mit dem Flachbandkabel verbunden und in das Gehäuse gelegt.
- Das Abschirmgehäuse wird über den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gelegt und alles mit dem LEMS-Gehäuse verschraubt.
- Das Display wird mit dem Flachbandkabel verbunden und auf das Gehäuse geklebt.
Software
4D-Systems stellt nicht nur das Display her, sondern bietet mit dem Workshop4 eine vollumfängliche Programmierumgebung. für die Programmierung des Codes, bediente sich das Projektteam an dieser Programmierumgebung und erstellte den gesamten Code darin. Dieser wurde, zum Zweck der Modularisierung und um der Übersichtlichkeit Rechnung zu tragen, in fünf Dateien aufgeteilt und hat einen Umfang von ca. 1500 Zeilen. Der grobe Programmablauf kann im Flussdiagramm entnommen werden.
Die Init-Datei
Die Init-Datei initialisiert die Kommunikation zu den Sensoren und ruft verschiedene Funktionen auf, um das LEMS betriebsbereit zu machen. Diese Datei wird nur beim Aufstarten des LEMS ausgeführt und dies lediglich ein Mal. Sie besteht aus 37 Zeilen.
Die Main-Datei
Über die Datei "Main" werden die Hauptfunktionen aufgerufen. Sie dient ausschliesslich diesem Zweck. Daraus resultiert, dass sie aus lediglich 19 Zeilen besteht und somit sehr übersichtlich ist.
Die Global- und Funktions-Datei
In dieser Datei werden sämtlich Folge-Funktionen aufgerufen, welche durch die in den Dateien "Main", "Touch" und "Release" enthaltenen Funktionen aufgerufen werden. Sie ist die grösste Datei und hat einen Umfang von 1245 Zeilen.
Die Touch-Datei
In der Touch-Datei werden alle Berührungen, die auf dem Display erfolgen, detektiert. Dies ist vor allem für die Aktivierungsfelder von hoher Wichtigkeit. Hier wird detektiert, ob der Finger des Anwenders das Display berührt und führt daraufhin die entsprechenden Aktionen aus. Sie umfasst 136 Zeilen.
Die Release-Datei
Anders als bei der Touch-Datei, werden die Aktionen erst ausgeführt, wenn sich der Finger wieder von der Displayoberfläche entfernt. Eine einfache Berührung des Displays löst noch keine Aktionen aus. Die Release-Datei umfasst 101 Zeilen Code.
Ausblick
Das LEMS wurde so konzipiert und getestet, dass die Möglichkeit besteht, dieses vertreiben zu können. Im Hinblick auf einen möglichen Vertrieb wären jedoch noch einige Dinge zu beachten. Zum einen kann, wie jeder Prozess, auch hier der Produktionsprozess noch verbessert werden. Mögliche Angriffspunkte hierbei wären, dass die Gehäuse des LEMS nicht mehr gefräst, sondern gegossen werden. Dies bedingt jedoch, dass Gussformen für das LEMS- aber auch für das Abschirmgehäuse angefertigt werden müssten. Dies ist aber mit einem erhöhten finanziellen Aufwand verbunden. Dieser finanzielle Aufwand könnte mit einer Erhöhung der Stückzahl in der Gross-Serie abgefangen, respektive kompensiert werden. Weiter sind die im Abschnitt Kosten aufgeführten Preise ohne Verhandlungen mit den Lieferanten entstanden. Sie basieren rein auf den Angaben, welche von den Bestellportalen angegebenen Preise, in den jeweiligen Stückzahlen, gemacht wurden. Durch direkte Verhandlungen mit den jeweiligen Lieferanten, oder bei Gross-Serien auch möglich, direkt mit den Herstellern, können erheblich bessere Preise erwartet werden.
Reflexion
Während der Diplomarbeit konnten wir auf die gemeinsame, aber auch auf getrennt erworbene Erfahrungen zurückgreifen. Es bestätigte sich wieder einmal mehr, dass wir uns super ergänzen und sehr viel voneinander lernen konnten. Was für uns neu war, war der Umfang der Arbeit mit Lieferanten, Prüfstätten und die Entwicklung eines Produktes von Anfang bis Ende mit einer Professionalität und in einer Qualität diesen Ausmasses. Die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt gestaltete sich unlängst schwieriger als vermutet.
Das gesamte Projekt wurde im Vorfeld sauber geplant, natürlich mit genügend Pufferzeit und Ausweichterminen, sodass wir während der gesamten Zeit nicht einmal Gefahr liefen, nur knapp oder sogar nicht fertig zu werden. Dies bewirkte, dass wir, trotz des massiven Arbeitsaufwandes, eine ziemlich entspannte Arbeitsatmosphäre hatten, was die Sache noch viel angenehmer gestaltete.
Abschliessend können wir beide klar sagen, dass die Arbeit viel Freude gemacht hat und wir jederzeit wieder zusammenarbeiten würden. Wir überlegen uns sogar, gemeinsam weiter zu studieren und ziehen ein Bachelor-Studium in Betracht.
Die Diplomarbeit ist aus unserer Sicht ein voller Erfolg.