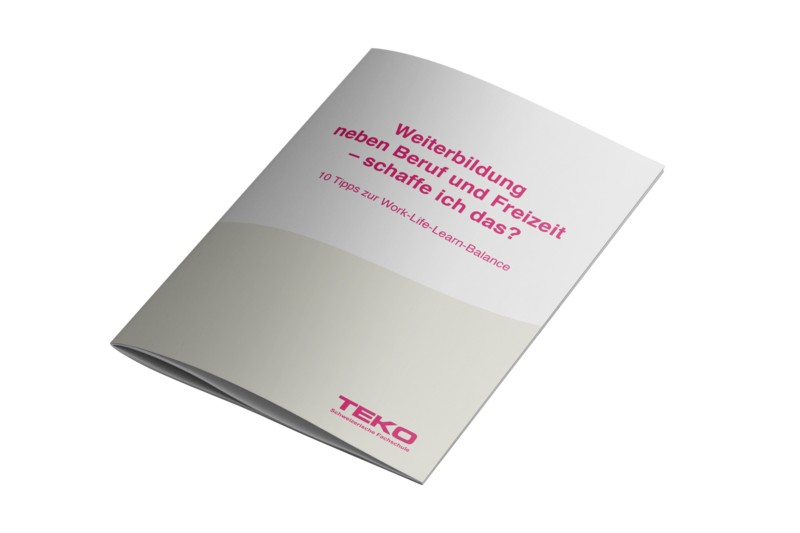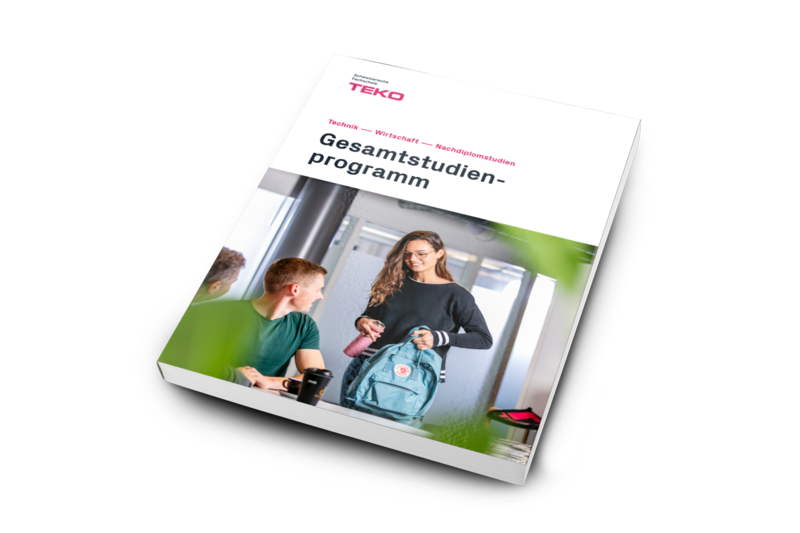Guten Tag!Es freut mich, dass Sie den Weg auf die Micro-Website meiner Diplomarbeit gefunden haben.Mithilfe dieser Plattform möchte ich Ihnen zeigen, was ich im Rahmen meiner Diplomarbeit geplant, entwickelt, gezeichnet, konstruiert und programmiert habe.Diese Arbeit bildet den Abschluss meines Studiums zum dipl. Techniker HF Elektrotechnik an der TEKO in Bern.Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!Die Arbeit in KürzeAn dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Überblick zu Ausgangslange, Inhalt und Umfang meiner Arbeit verschaffen.In der Galerie nach diesem Text, finden Sie zu jeder Etappe einige Bilder und Impressionen, welche den Entstehungs- und Erarbeitungsprozess aufzeigen.Am Ende dieser Seite finden Sie die vollständige Dokumentation als PDF-Download.Rechts neben diesem Text habe ich als ergänzende, technische Unterlagen das Elektroschema sowie eine anschauliche PDF-Version der Software hochgeladen.AusgangslageAller Anfang ist schwer – so (gerade) auch bei einer Arbeit, die einen Umfang von 150-250 Arbeitsstunden haben soll.Wo fängt man bei so etwas Grossem an?Tief durchatmen, Kaffee trinken, ins Grüne schauen, und dann: Das Fundament auslegen. Worum geht's? Wo komme ich her, wo bin ich und wo will ich hin?Ich komme von einer Lehre als Automatiker, beschäftige mich beruflich vor Allem mit Umbau und Anpassung von elektrischen Schaltanlagen. Wenn unter den Zuschauertribünen des Wankdorfstadions ein Fitnesscenter aus- und eine Hirslanden-Klinik einzieht, dabei aber irgendwie möglichst viel bestehende Infrastruktur übernommen werden soll – dann bin ich in meinem Element.Mithilfe meines beruflichen Fachwissens, den (Er-)Kenntnissen aus meinem Studium an der TEKO und ein Bisschen Flair für Elektrotechnik, wollte ich eine Anlage erstellen, welche meinen Eltern etwas Abhilfe schafft, bei einigen lange bekannten, aber nie gelösten Problem.Besagte Eltern bestellen gerne den Garten, gehen oft in die Ferien und verbringen (un-)freiwillig viel Zeit rauchend unter dem Pavillon ihres Hauses.Diesen drei Problematiken wollte ich in Form einer elektrischen Anlage Abhilfe schaffen, um ihnen ein wenig mehr Lebensqualität zu ermöglichen. So entstand das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät.Daraus entstand ein Projekt in 7 Akten:1. Initialisierung2. Planung3. Engineering4. Elektroschema5. Konstruktion6. Programmierung7. Nachbearbeitung und AuswertungDie Szenen jedes Aktes finden sie in der nachfolgenden Galerie. Vorhang auf!








































































































 / Der Vorhang schliesst sich... /
/ Der Vorhang schliesst sich... /
Das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät – der Prozess in Bildern

1/35
Erster Akt: Initialisierungsphase
1-1: Ausgangslage
Das Elternhaus mit 1) (Raucher-)Pavillon, 2) Blumen- und Gemüsebeeten, 3) Gartenschopf mit Regenwassertank
1-1: Ausgangslage
Das Elternhaus mit 1) (Raucher-)Pavillon, 2) Blumen- und Gemüsebeeten, 3) Gartenschopf mit Regenwassertank

2/35
1-2: Themeneingabe
Aus der Ausgangslage und einem Gag, aus dem später Ernst wurde, formulierte ich ein Projektthema: Es soll eine elektrische Anlage erstellt werden, welche eine Wetterstation (wie viele Jacken muss ich zum Rauchen anziehen?), eine Bewässerungssteuerung (wer giesst die Blumen wenn wir weg sind?), sowie eine Solaranlage (braucht denn das nicht zu viel Strom?) beinhaltet.
Aus der Ausgangslage und einem Gag, aus dem später Ernst wurde, formulierte ich ein Projektthema: Es soll eine elektrische Anlage erstellt werden, welche eine Wetterstation (wie viele Jacken muss ich zum Rauchen anziehen?), eine Bewässerungssteuerung (wer giesst die Blumen wenn wir weg sind?), sowie eine Solaranlage (braucht denn das nicht zu viel Strom?) beinhaltet.

3/35
1-3: Mindmap
Wie geht man mit all den Gedanken und Ideen um, die einem beim Erstellen einer so grossen Arbeit durch den Kopf strömen? Man lässt Strom zu (Bewegungs-)Fluss werden; in meinem Fall mit den Retro-Werkzeugen "Stift und Papier"
Wie geht man mit all den Gedanken und Ideen um, die einem beim Erstellen einer so grossen Arbeit durch den Kopf strömen? Man lässt Strom zu (Bewegungs-)Fluss werden; in meinem Fall mit den Retro-Werkzeugen "Stift und Papier"

4/35
1-4: Excel, Excel, Excel...
Aus den im Mindmap visualisierten Gedanken und Ideen versuchte ich eine grundlegende Struktur, einen roten Faden für meine Arbeit zu entwickeln. Dazu erstellte ich Excel-Tabellen für Arbeitsplan (in welcher Reihenfolge und wie lange ca. für jeden Arbeitsschritt?), Arbeitszeiterfassung (wie lange hatte ich den nun für jeden Arbeitsschritt?) und Zeitplan (geschätzte Zeitaufwände auf verfügbare Tage aufgeteilt)
Aus den im Mindmap visualisierten Gedanken und Ideen versuchte ich eine grundlegende Struktur, einen roten Faden für meine Arbeit zu entwickeln. Dazu erstellte ich Excel-Tabellen für Arbeitsplan (in welcher Reihenfolge und wie lange ca. für jeden Arbeitsschritt?), Arbeitszeiterfassung (wie lange hatte ich den nun für jeden Arbeitsschritt?) und Zeitplan (geschätzte Zeitaufwände auf verfügbare Tage aufgeteilt)

5/35
1-5: Vom Excel ins Visio
Den mit den Excel-Tabellen entwickelten roten Faden versuchte ich nun in rote Pfeil umzuwandeln; a.k.a.: visualisieren
Den mit den Excel-Tabellen entwickelten roten Faden versuchte ich nun in rote Pfeil umzuwandeln; a.k.a.: visualisieren

6/35
1-6: Vom Excel ins GANTT
Auch die Zeitplan-Tabelle versuchte ich zu visualisieren, um einen Überblick zu erhalten, bis wann ich mit jeder Etappe ca. fertig sein sollte
Auch die Zeitplan-Tabelle versuchte ich zu visualisieren, um einen Überblick zu erhalten, bis wann ich mit jeder Etappe ca. fertig sein sollte

7/35
Zweiter Akt: Planungsphase
2-1: Zielsetzungen
In einem nächsten Schritt vertiefte ich mich voller Elan in die Detailplanung meiner Arbeit. In dieser Phase wollte ich den genauen Funktions- und Anforderungsumfang meiner Anlage und damit den definitiven Arbeitsumfang meiner Arbeit abzustecken. Dazu formulierte ich zuerst meine Zielsetzungen.
Bei diesen unterschied ich zwischen ME- ("muss erfüllt"; wichtig, essentiell) und KE-Zielen ("kann erfüllt"; erweiterte Funktionen, zusätzliche Anforderungen)
2-1: Zielsetzungen
In einem nächsten Schritt vertiefte ich mich voller Elan in die Detailplanung meiner Arbeit. In dieser Phase wollte ich den genauen Funktions- und Anforderungsumfang meiner Anlage und damit den definitiven Arbeitsumfang meiner Arbeit abzustecken. Dazu formulierte ich zuerst meine Zielsetzungen.
Bei diesen unterschied ich zwischen ME- ("muss erfüllt"; wichtig, essentiell) und KE-Zielen ("kann erfüllt"; erweiterte Funktionen, zusätzliche Anforderungen)

8/35
2-2: Erfolgskriterien
Um am Ende bewerten zu können, ob meine Arbeit eher Erfolg oder Misserfolg war, formulierte ich in einem nächsten Schritt die Erfolgskriterien
Um am Ende bewerten zu können, ob meine Arbeit eher Erfolg oder Misserfolg war, formulierte ich in einem nächsten Schritt die Erfolgskriterien

9/35
2-3: Pflichtenheft
Die technischen Anforderungen und Eigenschaften, welche meine Arbeit haben soll, stellte ich in Form eines Pflichtenhefts zusammen
Die technischen Anforderungen und Eigenschaften, welche meine Arbeit haben soll, stellte ich in Form eines Pflichtenhefts zusammen

10/35
2-4: Detailplanung GANTT
Anhand aller bisher erstellten Tabellen überarbeitete, präzisierte und ergänzte ich meinen Arbeitsplan, teilte die Arbeiten auf die mir zur Verfügung stehenden Tage auf, und visualisierte das ganze in einem Detailplanungs-GANTT-Diagramm
Anhand aller bisher erstellten Tabellen überarbeitete, präzisierte und ergänzte ich meinen Arbeitsplan, teilte die Arbeiten auf die mir zur Verfügung stehenden Tage auf, und visualisierte das ganze in einem Detailplanungs-GANTT-Diagramm

11/35
Dritter Akt: Engineering
3-1: Variantenfindung 1: Signalverarbeitungsgerät – SPS oder Mikrocontroller?
Das Entwickeln der technischen Umsetzung meiner Ziele und des Pflichtenhefts lässt sich unter dem Begriff des "Engineerings" zusammenfassen.
Erste Etappe dabei: Analyse und Variantenfindung zur Frage nach dem Typ des Signalverarbeitungsgeräts. Die beiden realistischen Möglichkeiten für meine Arbeit waren: SPS (Typischerweise in der Gebäudeautomation eingesetzte Geräte, speziell für Steuerung und Automatisierung von Anlagen entwickelt) oder Mikrocontroller wie Arduino (kleine Computer, die praktisch alles können, was ein "richtiger" Computer auch kann, nur halt... in "mikro") .
Aufgrund dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für eine SPS des Typs "Siemens LOGO!"
3-1: Variantenfindung 1: Signalverarbeitungsgerät – SPS oder Mikrocontroller?
Das Entwickeln der technischen Umsetzung meiner Ziele und des Pflichtenhefts lässt sich unter dem Begriff des "Engineerings" zusammenfassen.
Erste Etappe dabei: Analyse und Variantenfindung zur Frage nach dem Typ des Signalverarbeitungsgeräts. Die beiden realistischen Möglichkeiten für meine Arbeit waren: SPS (Typischerweise in der Gebäudeautomation eingesetzte Geräte, speziell für Steuerung und Automatisierung von Anlagen entwickelt) oder Mikrocontroller wie Arduino (kleine Computer, die praktisch alles können, was ein "richtiger" Computer auch kann, nur halt... in "mikro") .
Aufgrund dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für eine SPS des Typs "Siemens LOGO!"

12/35
3-2: Variantenfindung 2: Signaltyp – Analog oder BUS?
Für die Signalübertragung der Messwerte von Sensoren zu einer Auswertungs- oder Verarbeitungseinheit gibt es heutzutage grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder via Analogsignal (Spannung zwischen 0-10V; Strom 4-20mA) oder über ein BUS-Protokoll (Binärsignal).
Doch welche der beiden Varianten wäre wohl sinnvoller für meine Arbeit?
Als Resultat dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für Analogsignale.
Für die Signalübertragung der Messwerte von Sensoren zu einer Auswertungs- oder Verarbeitungseinheit gibt es heutzutage grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder via Analogsignal (Spannung zwischen 0-10V; Strom 4-20mA) oder über ein BUS-Protokoll (Binärsignal).
Doch welche der beiden Varianten wäre wohl sinnvoller für meine Arbeit?
Als Resultat dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für Analogsignale.

13/35
3-3: Anlagedisposition
Um die Geräte zur Umsetzung meiner Funktionen definieren zu können, müsste ich erst einmal wissen, wie und wo was platziert wird, da sich daraus der benötigte IP-Schutzgrad ableiten lässt.
Dazu zeichnete ich im Vision eine Anlagedisposition, in Anlehnung an die im ersten Bild dieser Galerie gezeigte Situation vor Ort.
Um die Geräte zur Umsetzung meiner Funktionen definieren zu können, müsste ich erst einmal wissen, wie und wo was platziert wird, da sich daraus der benötigte IP-Schutzgrad ableiten lässt.
Dazu zeichnete ich im Vision eine Anlagedisposition, in Anlehnung an die im ersten Bild dieser Galerie gezeigte Situation vor Ort.

14/35
3-4: Excel, Excel, Excel... #2
Aus den Resultaten der bisher in dieser Etappe ausgeführten Arbeitsschritte, erstellte ich nun die wichtigsten Engineering-Dokumente:
-Komponentenliste: Mit welchem konkreten Gerät kann ich welches Ziel / Pflicht / Anforderung umsetzen?
-Datenpunktliste: Welche Datenpunkte (Signale, welche von der SPS erfasst oder ausgegeben werden) ergeben sich aus den gewählten Komponenten? Gibt der Energiezähler etwa seinen Messwert aus oder nicht?
-IO-Liste: Welchem Signaltyp (digital oder analog, Ein- oder Ausgangssignal) entsprechen die Datenpunkte?
Aus den Resultaten der bisher in dieser Etappe ausgeführten Arbeitsschritte, erstellte ich nun die wichtigsten Engineering-Dokumente:
-Komponentenliste: Mit welchem konkreten Gerät kann ich welches Ziel / Pflicht / Anforderung umsetzen?
-Datenpunktliste: Welche Datenpunkte (Signale, welche von der SPS erfasst oder ausgegeben werden) ergeben sich aus den gewählten Komponenten? Gibt der Energiezähler etwa seinen Messwert aus oder nicht?
-IO-Liste: Welchem Signaltyp (digital oder analog, Ein- oder Ausgangssignal) entsprechen die Datenpunkte?

15/35
3-5: SPS-Konfiguration
SPS-Systeme sind i.d.R. modular aufgebaut, d.h. es gibt Module für analoge Eingangssignale, digitale Ausgangssignale, Kommunikationsmodule etc.
Hat man einmal definiert, welche Anzahl je Signaltyp man braucht, so wie ich es mit der IO-Liste getan habe, kann man daraus Anzahl und Typ der Module ableiten, was zu einem Resultat wie oben führen kann.
Die Geräte ganz links sind die "Controller", also der "Rechner". Davon habe ich zwei benötigt, da jeder einzelne nur eine bestimmte Anzahl Signale verarbeiten kann.
Es handelt sich hierbei um eine SPS des Typ "Siemens LOGO!", da diese besonders angenehm zu programmieren ist (es muss kein Code geschrieben werden).
SPS-Systeme sind i.d.R. modular aufgebaut, d.h. es gibt Module für analoge Eingangssignale, digitale Ausgangssignale, Kommunikationsmodule etc.
Hat man einmal definiert, welche Anzahl je Signaltyp man braucht, so wie ich es mit der IO-Liste getan habe, kann man daraus Anzahl und Typ der Module ableiten, was zu einem Resultat wie oben führen kann.
Die Geräte ganz links sind die "Controller", also der "Rechner". Davon habe ich zwei benötigt, da jeder einzelne nur eine bestimmte Anzahl Signale verarbeiten kann.
Es handelt sich hierbei um eine SPS des Typ "Siemens LOGO!", da diese besonders angenehm zu programmieren ist (es muss kein Code geschrieben werden).

16/35
Vierter Akt: Elektroschema
4-1: Seitenstruktur
Die nächste grosse Etappe meiner Arbeit, war die Erstellung des Elektroschema mittels CAD-Zeichnungstool "EPLAN", welches in unserer Firma für alle Schaltanlagen verwendet wird.
In einem ersten Schritt erstellte ich die Grundlegende Seitenstruktur von diesen.
4-1: Seitenstruktur
Die nächste grosse Etappe meiner Arbeit, war die Erstellung des Elektroschema mittels CAD-Zeichnungstool "EPLAN", welches in unserer Firma für alle Schaltanlagen verwendet wird.
In einem ersten Schritt erstellte ich die Grundlegende Seitenstruktur von diesen.

17/35
4-2: Stromlaufplan
Der nächste, und umfangreichste Schritt dieser Etappe, war die Erstellung des Stromlaufplans. Dabei handelt es sich um eine Darstellungsform elektrischer Schaltungen und deren Verdrahtung. Die Geräte werden mit Symbolen dargestellt, bei welchen ihre Anschlüsse eingetragen sind. Die Verbindungslinien zwischen diesen stehen für die elektrischen Verbindungen in Form von Drähten, Kabeln oder Schienen.
Der Stromlaufplan dient mir somit als Anleitung zur Verdrahtung meiner Steuerung.
Der nächste, und umfangreichste Schritt dieser Etappe, war die Erstellung des Stromlaufplans. Dabei handelt es sich um eine Darstellungsform elektrischer Schaltungen und deren Verdrahtung. Die Geräte werden mit Symbolen dargestellt, bei welchen ihre Anschlüsse eingetragen sind. Die Verbindungslinien zwischen diesen stehen für die elektrischen Verbindungen in Form von Drähten, Kabeln oder Schienen.
Der Stromlaufplan dient mir somit als Anleitung zur Verdrahtung meiner Steuerung.

18/35
4-3: Prinzipschema
Mit einem sogenannten "Prinzipschema", auch RI-Fliessschema genannt, werden die Flüssigkeitsleitungen zwischen (elektrischen) Geräten, bspw. Ventile und Hähne, dargestellt. Um später einen Demoaufbau für meine Bewässerungssteuerung realisieren zu können, erstellte ich ein solches mit den im Stromlaufplan gezeichneten Elementen.
Mit einem sogenannten "Prinzipschema", auch RI-Fliessschema genannt, werden die Flüssigkeitsleitungen zwischen (elektrischen) Geräten, bspw. Ventile und Hähne, dargestellt. Um später einen Demoaufbau für meine Bewässerungssteuerung realisieren zu können, erstellte ich ein solches mit den im Stromlaufplan gezeichneten Elementen.

19/35
Fünfter Akt: Konstruktion
5-1: Testaufbau Wetterstation
Nach Fertigstellung des Elektroschemas konnte ich mich an die physische Umsetzung meiner Steuerung machen.
Dabei wollte ich für jeden Anlageteil einen Demonstrationsaufbau realisieren, um die Funktionen der Feldgeräte testen zu können.
Die Konstruktion der Wetterstation beschränkte sich daher auf oben gezeigte Variante, mit welcher ich Funktion und Signalübertragung der Sensoren zur SPS prüfen konnte.
5-1: Testaufbau Wetterstation
Nach Fertigstellung des Elektroschemas konnte ich mich an die physische Umsetzung meiner Steuerung machen.
Dabei wollte ich für jeden Anlageteil einen Demonstrationsaufbau realisieren, um die Funktionen der Feldgeräte testen zu können.
Die Konstruktion der Wetterstation beschränkte sich daher auf oben gezeigte Variante, mit welcher ich Funktion und Signalübertragung der Sensoren zur SPS prüfen konnte.

20/35
5-2: Konstruktion Bewässerungssteuerung
Der Demoaufbau der Bewässerungssteuerung folgt der Anordnung der Komponenten, wie sie auf dem Prinzipschema auf Bild 4-3 gezeigt ist.
Pumpe und Ventile sind über transparente Schläuche verbunden, was mir eine optische Nachverfolgung des Wasserflusses ermöglichte.
Der Demoaufbau der Bewässerungssteuerung folgt der Anordnung der Komponenten, wie sie auf dem Prinzipschema auf Bild 4-3 gezeigt ist.
Pumpe und Ventile sind über transparente Schläuche verbunden, was mir eine optische Nachverfolgung des Wasserflusses ermöglichte.

21/35
5-3: Disposition SGK
Für die Erstellung der Steuerung stellte ich die Komponenten zusammen, und ordnete sie an, sodass eine Bedienung später möglichst intuitiv von der Hand gehen würde.
Für die Erstellung der Steuerung stellte ich die Komponenten zusammen, und ordnete sie an, sodass eine Bedienung später möglichst intuitiv von der Hand gehen würde.

22/35
5-4: Bearbeitung Steuerungsgehäuse mit CNC-Bearbeitungscenter
Im Rahmen meiner Arbeit durfte ich auf eine der grossen Errungenschaften der Lescom AG zurückgreifen: Ein CNC-Bearbeitungscenter, welches Löcher, Gewinde und Ausschnitte punktgenau in Steuerungsgehäuse aller Arten einarbeiten kann.
Im Rahmen meiner Arbeit durfte ich auf eine der grossen Errungenschaften der Lescom AG zurückgreifen: Ein CNC-Bearbeitungscenter, welches Löcher, Gewinde und Ausschnitte punktgenau in Steuerungsgehäuse aller Arten einarbeiten kann.

23/35
5-5: Aufbau Steuerung
Nach der Bearbeitung durch das CNC-Bearbeitungscenter bestückte und beschriftete ich das Gehäuse meiner Steuerung
Nach der Bearbeitung durch das CNC-Bearbeitungscenter bestückte und beschriftete ich das Gehäuse meiner Steuerung

24/35
5-6: Verdrahtung
Im letzten Schritt dieser Etappe erfolgte die Verdrahtung meiner Steuerung. Als gelernter Automatiker konnte ich mich hierbei richtig austoben.
Im letzten Schritt dieser Etappe erfolgte die Verdrahtung meiner Steuerung. Als gelernter Automatiker konnte ich mich hierbei richtig austoben.

25/35
Sechster Akt: Programmierung
6-1: Netzwerkkonfiguration
Aller Anfang ist... IP-Adressen vergeben.
Computer, und dazu gehört auch meine SPS, reden gerne nicht, oder nur ins Leere.
Es sei denn, man widmet seiner Netzwerkkonfiguration ein wenig Zuneigung.
Da ich zwei Controller und ein Display verbaut habe, bestand hierzu (Nachhol-)Bedarf.
Zum Glück – und das war auch ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung für dieses System – bietet die Programmieroberfläche dieser SPS ein angenehmes Tool dafür.
6-1: Netzwerkkonfiguration
Aller Anfang ist... IP-Adressen vergeben.
Computer, und dazu gehört auch meine SPS, reden gerne nicht, oder nur ins Leere.
Es sei denn, man widmet seiner Netzwerkkonfiguration ein wenig Zuneigung.
Da ich zwei Controller und ein Display verbaut habe, bestand hierzu (Nachhol-)Bedarf.
Zum Glück – und das war auch ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung für dieses System – bietet die Programmieroberfläche dieser SPS ein angenehmes Tool dafür.

26/35
6-2: Testoberfläche
Hier sehen Sie die Grundlegende Funktionsweise der Software, mit welcher die Programmierung der SPS "Siemens LOGO!" erfolgt: Die physischen Signalanschlüsse der SPS werden als Blöcke dargestellt; optisch ähnelt die resultierende Programmierung daher einem Stromlaufplan.
Was mit den Signalen geschieht, wird durch die gezogenen Verbindungen zwischen den Blöcken bestimmt.
Zu Beginn der Programmierung erstellte ich obige Testoberfläche, um prüfen zu können, ob die jeweiligen Signale am "richtigen Ort", also dem richtigen Block ankommen.
Hier sehen Sie die Grundlegende Funktionsweise der Software, mit welcher die Programmierung der SPS "Siemens LOGO!" erfolgt: Die physischen Signalanschlüsse der SPS werden als Blöcke dargestellt; optisch ähnelt die resultierende Programmierung daher einem Stromlaufplan.
Was mit den Signalen geschieht, wird durch die gezogenen Verbindungen zwischen den Blöcken bestimmt.
Zu Beginn der Programmierung erstellte ich obige Testoberfläche, um prüfen zu können, ob die jeweiligen Signale am "richtigen Ort", also dem richtigen Block ankommen.

27/35
6-3: Skalierung Signale
Dieses Bild zeigt anschaulich, wie die Signalverarbeitung mit Blöcken und Verbindungen funktioniert: Möchte ich bspw. das 0-10V Signal meines Luftfeuchtigkeitssensor in einen Wert von 0-100% Umwandeln, so muss ich dazu lediglich den Block, welcher den Signaleingang darstellt, mit einem Funktionsblock "Analogverstärker" verbinden. Letzterer verfügt dann über einstellbare Parameter, welche mir eine Skalierung des Eingangswertes ermögliche.
Den umgerechneten, also skalierten Wert, kann ich danach auf dem mit einer Verbindung zu einem Funktionsblock "Meldetext" auf dem Display anzeigen lassen.
Dieses Bild zeigt anschaulich, wie die Signalverarbeitung mit Blöcken und Verbindungen funktioniert: Möchte ich bspw. das 0-10V Signal meines Luftfeuchtigkeitssensor in einen Wert von 0-100% Umwandeln, so muss ich dazu lediglich den Block, welcher den Signaleingang darstellt, mit einem Funktionsblock "Analogverstärker" verbinden. Letzterer verfügt dann über einstellbare Parameter, welche mir eine Skalierung des Eingangswertes ermögliche.
Den umgerechneten, also skalierten Wert, kann ich danach auf dem mit einer Verbindung zu einem Funktionsblock "Meldetext" auf dem Display anzeigen lassen.

28/35
6-4: Programmierung Bewässerungssteuerung
Dieses Bild zeigt die softwaretechnische Umsetzung der Bewässerung des Gartens mit 3 Zonen, für welche jeweils die gewünschte Wassermenge eingestellt werden kann.
Die Logik dahinter entspricht dabei derselben, wie im vorherigen Bild beschrieben, nur dass hier analoge (dicke, schwarze Linien zwischen den Blöcken) und digitale Signale (dünne Linien) parallel und Gleichzeitig verarbeitet werden.
Dieses Bild zeigt die softwaretechnische Umsetzung der Bewässerung des Gartens mit 3 Zonen, für welche jeweils die gewünschte Wassermenge eingestellt werden kann.
Die Logik dahinter entspricht dabei derselben, wie im vorherigen Bild beschrieben, nur dass hier analoge (dicke, schwarze Linien zwischen den Blöcken) und digitale Signale (dünne Linien) parallel und Gleichzeitig verarbeitet werden.

29/35
Siebenter und letzter Akt: Auswertung und Reflexion
7-1: Fehleranalyse
Nach Abschluss der Programmierung, und damit der physischen Arbeiten an meiner Anlage, ging es an die Auswertung, und damit den Schlussakt dieses Projektes.
Dazu führte ich in einem ersten Schritt eine Fehleranalyse durch, d.h. eine Aufarbeitung einiger beispielhafter Fehler, welche mir während des Entstehungs- und Erarbeitungsprozesses widerfuhren.
Dieses Bild zeigt einen davon: Die Energie der Solaranlage wird über einen Wechselrichter in eine 230V-Wechselspannung, wie sie an jeder gewöhnlichen Steckdose abgegriffen werden kann, umgewandelt. Dadurch kann die Anlage ohne weitere exotische Geräte mit Solarenergie betrieben werden.
Der Haken an der Sache: Der verwendete Wechselrichter hat eine "Schuko-Steckdose", welche nicht zwischen Phase und Neutralleiter unterscheidet. Dies wurde mir bei der Umschaltung zum Verhängnis, da ich dadurch an meinem Netzteil eine Verpolung von Phase und Neutralleiter auslöste.
Die Lösung: Stecker umgekehrt einstecken.
7-1: Fehleranalyse
Nach Abschluss der Programmierung, und damit der physischen Arbeiten an meiner Anlage, ging es an die Auswertung, und damit den Schlussakt dieses Projektes.
Dazu führte ich in einem ersten Schritt eine Fehleranalyse durch, d.h. eine Aufarbeitung einiger beispielhafter Fehler, welche mir während des Entstehungs- und Erarbeitungsprozesses widerfuhren.
Dieses Bild zeigt einen davon: Die Energie der Solaranlage wird über einen Wechselrichter in eine 230V-Wechselspannung, wie sie an jeder gewöhnlichen Steckdose abgegriffen werden kann, umgewandelt. Dadurch kann die Anlage ohne weitere exotische Geräte mit Solarenergie betrieben werden.
Der Haken an der Sache: Der verwendete Wechselrichter hat eine "Schuko-Steckdose", welche nicht zwischen Phase und Neutralleiter unterscheidet. Dies wurde mir bei der Umschaltung zum Verhängnis, da ich dadurch an meinem Netzteil eine Verpolung von Phase und Neutralleiter auslöste.
Die Lösung: Stecker umgekehrt einstecken.

30/35
7-2: Auswertung Zeitplan Soll-Ist
In einem nächsten Schritt verglich ich die geschätzten, mit den effektiven Zeitaufwänden je Arbeitsschritt und bildete die Summen davon.
Fazit: Ich benötigte deutlich mehr Zeit als geplant, da sich das Projekt als viel schwieriger und aufwendiger herausstellte, als ich zu Beginn erwartet hätte.
In einem nächsten Schritt verglich ich die geschätzten, mit den effektiven Zeitaufwänden je Arbeitsschritt und bildete die Summen davon.
Fazit: Ich benötigte deutlich mehr Zeit als geplant, da sich das Projekt als viel schwieriger und aufwendiger herausstellte, als ich zu Beginn erwartet hätte.

31/35
7-3: Auswertung Pflichtenheft
Nun wertete ich die Erfüllung des Pflichtenheftes aus: Wie viele Elemente enthält dieses insgesamt, und wie viele davon wurden erfüllt?
Ein kurz und knappe Antwort auf diese Frage sehen Sie oben: Mit einer Erfüllungsquote von über 95% bin ich sicher auf einem guten Stand angekommen.
Die paar wenigen, nicht erfüllten Elemente, torpedieren denn auch nicht die Funktionsfähigkeit der Anlage. Es handelt sich dabei etwa um die Steuerung der Anlage via SMS, für welche ich zwar die physischen Voraussetzungen geschaffen (GSM-Modul montiert und installiert), aber noch nicht die Zeit für eine Implementierung auf Softwareebene hatte.
Nun wertete ich die Erfüllung des Pflichtenheftes aus: Wie viele Elemente enthält dieses insgesamt, und wie viele davon wurden erfüllt?
Ein kurz und knappe Antwort auf diese Frage sehen Sie oben: Mit einer Erfüllungsquote von über 95% bin ich sicher auf einem guten Stand angekommen.
Die paar wenigen, nicht erfüllten Elemente, torpedieren denn auch nicht die Funktionsfähigkeit der Anlage. Es handelt sich dabei etwa um die Steuerung der Anlage via SMS, für welche ich zwar die physischen Voraussetzungen geschaffen (GSM-Modul montiert und installiert), aber noch nicht die Zeit für eine Implementierung auf Softwareebene hatte.

32/35
7-4: Auswertung Zieldefinitionen
An dieser Stelle komme ich zur zweitwichtigsten Frage dieses Kapitels: Konnte ich die Ziele, die ich mir zu Beginn der Arbeit gesetzt hatte, erfüllen?
Kurz: Ja, ich denke, das darf ich so behaupten.
Durch die Unterteilung der Ziele in grundlegende, essentielle (ME-Ziele) und erweiterte, zusätzliche Funktionen (KE-Ziele), konnte ich bei der gegen Ende hin knapp werdenden Zeit zwischen "wichtigen" und "nicht ganz so wichtigen" Arbeitsschritten priorisieren.
Die Erfüllung von 100% der ME-Ziele zeigt, dass mir dies recht gut gelungen ist.
Die zu 78% erreichten KE-Ziele lassen den Schluss zu, dass die Anlage doch über einen Grossteil (auch der erweiterten) Funktionen verfügt. Die hier übrig gebliebenen 22% sind allesamt solche, die auf Softwareebene nachträglich, oder physisch mit geringem Aufwand noch implementiert werden können – etwa die beim letzten Bild bereits erwähnte Ansteuerung der Anlage via SMS-Befehle.
An dieser Stelle komme ich zur zweitwichtigsten Frage dieses Kapitels: Konnte ich die Ziele, die ich mir zu Beginn der Arbeit gesetzt hatte, erfüllen?
Kurz: Ja, ich denke, das darf ich so behaupten.
Durch die Unterteilung der Ziele in grundlegende, essentielle (ME-Ziele) und erweiterte, zusätzliche Funktionen (KE-Ziele), konnte ich bei der gegen Ende hin knapp werdenden Zeit zwischen "wichtigen" und "nicht ganz so wichtigen" Arbeitsschritten priorisieren.
Die Erfüllung von 100% der ME-Ziele zeigt, dass mir dies recht gut gelungen ist.
Die zu 78% erreichten KE-Ziele lassen den Schluss zu, dass die Anlage doch über einen Grossteil (auch der erweiterten) Funktionen verfügt. Die hier übrig gebliebenen 22% sind allesamt solche, die auf Softwareebene nachträglich, oder physisch mit geringem Aufwand noch implementiert werden können – etwa die beim letzten Bild bereits erwähnte Ansteuerung der Anlage via SMS-Befehle.

33/35
7-5: Auswertung Erfolgskriterien
Die letzte – und wohl wichtigste – Auswertung meiner Arbeit bildet jene der Erfolgskriterien. Denn, ob ein Projekt insgesamt als Erfolg gewertet werden kann hängt, nun ja, wohl eben davon ab, ob die Erfolgskriterien erfüllt wurden.
Wie im Screenshot oben zu sehen, fehlte mir hier nur ein "halbes" Erfolgskriterium zu einer vollständigen Erfüllung.
Dieses "halbe" ergibt sich aus der von mir leider etwas unglücklich gewählten Formulierung des Erfolgskriteriums:
"Der Inhaltliche und zeitliche Rahmen für die Arbeit wurde eingehalten".
Inhaltlich enthält die Arbeit alle in Richtlinien und Vorgaben geforderten Elemente, allerdings habe ich den zeitlichen Rahmen von 150-250 Stunden Arbeitsaufwand überschritten.
Diese Übertretung nahm ich allerdings auch in kauf, da ich während der Arbeit die Entscheidung getroffen habe: Lieber zu viel Zeit aufgewendet, dafür etwas qualitativ hochwertiges, fertiges abgeben, hinter dem ich mit gutem Gewissen stehen kann.
Somit darf die Arbeit insgesamt als Erfolg gewertet werden.
Die letzte – und wohl wichtigste – Auswertung meiner Arbeit bildet jene der Erfolgskriterien. Denn, ob ein Projekt insgesamt als Erfolg gewertet werden kann hängt, nun ja, wohl eben davon ab, ob die Erfolgskriterien erfüllt wurden.
Wie im Screenshot oben zu sehen, fehlte mir hier nur ein "halbes" Erfolgskriterium zu einer vollständigen Erfüllung.
Dieses "halbe" ergibt sich aus der von mir leider etwas unglücklich gewählten Formulierung des Erfolgskriteriums:
"Der Inhaltliche und zeitliche Rahmen für die Arbeit wurde eingehalten".
Inhaltlich enthält die Arbeit alle in Richtlinien und Vorgaben geforderten Elemente, allerdings habe ich den zeitlichen Rahmen von 150-250 Stunden Arbeitsaufwand überschritten.
Diese Übertretung nahm ich allerdings auch in kauf, da ich während der Arbeit die Entscheidung getroffen habe: Lieber zu viel Zeit aufgewendet, dafür etwas qualitativ hochwertiges, fertiges abgeben, hinter dem ich mit gutem Gewissen stehen kann.
Somit darf die Arbeit insgesamt als Erfolg gewertet werden.

34/35
7-6: Lessons Learned
Zum Abschluss dieser Arbeit versuchte ich einige "Lessons Learned" zu formulieren, also Dinge die ich im Rahmen dieser Arbeit gelernt habe und mitnehmen möchte.
Das wohl anschaulichste Beispiel für ein solches, sehen sie auf diesem Bild.
Ich testete die Umschaltung auf Solarenergie erst mit einer eher kleinen Batterie mit einer Kapazität von 7Ah und 12V Nennspannung.
Nach einigen erfolgreichen Testdurchläufen funktionierte die Umschaltung plötzlich nicht mehr, und ich begann mit der Fehlersuche.
Es stellte sich heraus: Wird der – im Verhältnis zur Batterie relativ grosse – Wechselrichter (600W) zugeschaltet, so wird die Spannung der Batterie ob der grossen Last "zusammengezogen".
Ist die 7Ah-Batterie auf 12V geladen, fällt ihre Spannung unter der Last des Wechselrichters auf rund 11V ab. Dabei wird der implementierte Mechanismus zur Spannungsüberwachung aktiv, welcher die Batterie aus Sicherheitsgründen von der Last trennt.
Lösung: Die im Bild gezeigte Batterie hat eine Kapazität von 18Ah; ist sie auf 12,8V geladen, fällt ihre Spannung unter Last auf nicht weniger als 12,3V – also ein deutlich geringerer Spannungsabfall als bei der "kleinen" Batterie.
Damit ist sie weit von den 11V entfernt, welchen ich als Schwellwert zur Trennung der Batterie von der Last definiert habe.
Zum Abschluss dieser Arbeit versuchte ich einige "Lessons Learned" zu formulieren, also Dinge die ich im Rahmen dieser Arbeit gelernt habe und mitnehmen möchte.
Das wohl anschaulichste Beispiel für ein solches, sehen sie auf diesem Bild.
Ich testete die Umschaltung auf Solarenergie erst mit einer eher kleinen Batterie mit einer Kapazität von 7Ah und 12V Nennspannung.
Nach einigen erfolgreichen Testdurchläufen funktionierte die Umschaltung plötzlich nicht mehr, und ich begann mit der Fehlersuche.
Es stellte sich heraus: Wird der – im Verhältnis zur Batterie relativ grosse – Wechselrichter (600W) zugeschaltet, so wird die Spannung der Batterie ob der grossen Last "zusammengezogen".
Ist die 7Ah-Batterie auf 12V geladen, fällt ihre Spannung unter der Last des Wechselrichters auf rund 11V ab. Dabei wird der implementierte Mechanismus zur Spannungsüberwachung aktiv, welcher die Batterie aus Sicherheitsgründen von der Last trennt.
Lösung: Die im Bild gezeigte Batterie hat eine Kapazität von 18Ah; ist sie auf 12,8V geladen, fällt ihre Spannung unter Last auf nicht weniger als 12,3V – also ein deutlich geringerer Spannungsabfall als bei der "kleinen" Batterie.
Damit ist sie weit von den 11V entfernt, welchen ich als Schwellwert zur Trennung der Batterie von der Last definiert habe.

35/35
7-7: Abschluss und Fazit
Damit bin ich am Ende meiner Arbeit angelangt.
Das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät in seiner fertigen Form ziert denn auch das letzte Bild dieser Galerie.
Ich konnte im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Projekt durchführen, bei dem ich planen, entwickeln, designen, zeichnen, konstruieren, programmieren und dokumentieren durfte.
Wie die Magie der Elektrotechnik zur Behebung von lange bekannten, aber nie gelösten Problem eingesetzt werden kann – konnte ich Ihnen hoffentlich mit dieser Präsentation meiner Arbeit aufzeigen.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch auf dieser Website.
Sollten Sie sich für eine detailliertere Dokumentation meiner Arbeit interessieren, so steht sie Ihnen nachfolgend als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. Ausserdem habe ich Downloadlinks zur technischen Dokumentation, bestehend aus Software und Elektroschema, unter meinem Profil am Anfang dieser Website hinterlegt.
Damit bin ich am Ende meiner Arbeit angelangt.
Das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät in seiner fertigen Form ziert denn auch das letzte Bild dieser Galerie.
Ich konnte im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Projekt durchführen, bei dem ich planen, entwickeln, designen, zeichnen, konstruieren, programmieren und dokumentieren durfte.
Wie die Magie der Elektrotechnik zur Behebung von lange bekannten, aber nie gelösten Problem eingesetzt werden kann – konnte ich Ihnen hoffentlich mit dieser Präsentation meiner Arbeit aufzeigen.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch auf dieser Website.
Sollten Sie sich für eine detailliertere Dokumentation meiner Arbeit interessieren, so steht sie Ihnen nachfolgend als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. Ausserdem habe ich Downloadlinks zur technischen Dokumentation, bestehend aus Software und Elektroschema, unter meinem Profil am Anfang dieser Website hinterlegt.

1/35
Erster Akt: Initialisierungsphase
1-1: Ausgangslage
Das Elternhaus mit 1) (Raucher-)Pavillon, 2) Blumen- und Gemüsebeeten, 3) Gartenschopf mit Regenwassertank
1-1: Ausgangslage
Das Elternhaus mit 1) (Raucher-)Pavillon, 2) Blumen- und Gemüsebeeten, 3) Gartenschopf mit Regenwassertank

2/35
1-2: Themeneingabe
Aus der Ausgangslage und einem Gag, aus dem später Ernst wurde, formulierte ich ein Projektthema: Es soll eine elektrische Anlage erstellt werden, welche eine Wetterstation (wie viele Jacken muss ich zum Rauchen anziehen?), eine Bewässerungssteuerung (wer giesst die Blumen wenn wir weg sind?), sowie eine Solaranlage (braucht denn das nicht zu viel Strom?) beinhaltet.
Aus der Ausgangslage und einem Gag, aus dem später Ernst wurde, formulierte ich ein Projektthema: Es soll eine elektrische Anlage erstellt werden, welche eine Wetterstation (wie viele Jacken muss ich zum Rauchen anziehen?), eine Bewässerungssteuerung (wer giesst die Blumen wenn wir weg sind?), sowie eine Solaranlage (braucht denn das nicht zu viel Strom?) beinhaltet.

3/35
1-3: Mindmap
Wie geht man mit all den Gedanken und Ideen um, die einem beim Erstellen einer so grossen Arbeit durch den Kopf strömen? Man lässt Strom zu (Bewegungs-)Fluss werden; in meinem Fall mit den Retro-Werkzeugen "Stift und Papier"
Wie geht man mit all den Gedanken und Ideen um, die einem beim Erstellen einer so grossen Arbeit durch den Kopf strömen? Man lässt Strom zu (Bewegungs-)Fluss werden; in meinem Fall mit den Retro-Werkzeugen "Stift und Papier"

4/35
1-4: Excel, Excel, Excel...
Aus den im Mindmap visualisierten Gedanken und Ideen versuchte ich eine grundlegende Struktur, einen roten Faden für meine Arbeit zu entwickeln. Dazu erstellte ich Excel-Tabellen für Arbeitsplan (in welcher Reihenfolge und wie lange ca. für jeden Arbeitsschritt?), Arbeitszeiterfassung (wie lange hatte ich den nun für jeden Arbeitsschritt?) und Zeitplan (geschätzte Zeitaufwände auf verfügbare Tage aufgeteilt)
Aus den im Mindmap visualisierten Gedanken und Ideen versuchte ich eine grundlegende Struktur, einen roten Faden für meine Arbeit zu entwickeln. Dazu erstellte ich Excel-Tabellen für Arbeitsplan (in welcher Reihenfolge und wie lange ca. für jeden Arbeitsschritt?), Arbeitszeiterfassung (wie lange hatte ich den nun für jeden Arbeitsschritt?) und Zeitplan (geschätzte Zeitaufwände auf verfügbare Tage aufgeteilt)

5/35
1-5: Vom Excel ins Visio
Den mit den Excel-Tabellen entwickelten roten Faden versuchte ich nun in rote Pfeil umzuwandeln; a.k.a.: visualisieren
Den mit den Excel-Tabellen entwickelten roten Faden versuchte ich nun in rote Pfeil umzuwandeln; a.k.a.: visualisieren

6/35
1-6: Vom Excel ins GANTT
Auch die Zeitplan-Tabelle versuchte ich zu visualisieren, um einen Überblick zu erhalten, bis wann ich mit jeder Etappe ca. fertig sein sollte
Auch die Zeitplan-Tabelle versuchte ich zu visualisieren, um einen Überblick zu erhalten, bis wann ich mit jeder Etappe ca. fertig sein sollte

7/35
Zweiter Akt: Planungsphase
2-1: Zielsetzungen
In einem nächsten Schritt vertiefte ich mich voller Elan in die Detailplanung meiner Arbeit. In dieser Phase wollte ich den genauen Funktions- und Anforderungsumfang meiner Anlage und damit den definitiven Arbeitsumfang meiner Arbeit abzustecken. Dazu formulierte ich zuerst meine Zielsetzungen.
Bei diesen unterschied ich zwischen ME- ("muss erfüllt"; wichtig, essentiell) und KE-Zielen ("kann erfüllt"; erweiterte Funktionen, zusätzliche Anforderungen)
2-1: Zielsetzungen
In einem nächsten Schritt vertiefte ich mich voller Elan in die Detailplanung meiner Arbeit. In dieser Phase wollte ich den genauen Funktions- und Anforderungsumfang meiner Anlage und damit den definitiven Arbeitsumfang meiner Arbeit abzustecken. Dazu formulierte ich zuerst meine Zielsetzungen.
Bei diesen unterschied ich zwischen ME- ("muss erfüllt"; wichtig, essentiell) und KE-Zielen ("kann erfüllt"; erweiterte Funktionen, zusätzliche Anforderungen)

8/35
2-2: Erfolgskriterien
Um am Ende bewerten zu können, ob meine Arbeit eher Erfolg oder Misserfolg war, formulierte ich in einem nächsten Schritt die Erfolgskriterien
Um am Ende bewerten zu können, ob meine Arbeit eher Erfolg oder Misserfolg war, formulierte ich in einem nächsten Schritt die Erfolgskriterien

9/35
2-3: Pflichtenheft
Die technischen Anforderungen und Eigenschaften, welche meine Arbeit haben soll, stellte ich in Form eines Pflichtenhefts zusammen
Die technischen Anforderungen und Eigenschaften, welche meine Arbeit haben soll, stellte ich in Form eines Pflichtenhefts zusammen

10/35
2-4: Detailplanung GANTT
Anhand aller bisher erstellten Tabellen überarbeitete, präzisierte und ergänzte ich meinen Arbeitsplan, teilte die Arbeiten auf die mir zur Verfügung stehenden Tage auf, und visualisierte das ganze in einem Detailplanungs-GANTT-Diagramm
Anhand aller bisher erstellten Tabellen überarbeitete, präzisierte und ergänzte ich meinen Arbeitsplan, teilte die Arbeiten auf die mir zur Verfügung stehenden Tage auf, und visualisierte das ganze in einem Detailplanungs-GANTT-Diagramm

11/35
Dritter Akt: Engineering
3-1: Variantenfindung 1: Signalverarbeitungsgerät – SPS oder Mikrocontroller?
Das Entwickeln der technischen Umsetzung meiner Ziele und des Pflichtenhefts lässt sich unter dem Begriff des "Engineerings" zusammenfassen.
Erste Etappe dabei: Analyse und Variantenfindung zur Frage nach dem Typ des Signalverarbeitungsgeräts. Die beiden realistischen Möglichkeiten für meine Arbeit waren: SPS (Typischerweise in der Gebäudeautomation eingesetzte Geräte, speziell für Steuerung und Automatisierung von Anlagen entwickelt) oder Mikrocontroller wie Arduino (kleine Computer, die praktisch alles können, was ein "richtiger" Computer auch kann, nur halt... in "mikro") .
Aufgrund dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für eine SPS des Typs "Siemens LOGO!"
3-1: Variantenfindung 1: Signalverarbeitungsgerät – SPS oder Mikrocontroller?
Das Entwickeln der technischen Umsetzung meiner Ziele und des Pflichtenhefts lässt sich unter dem Begriff des "Engineerings" zusammenfassen.
Erste Etappe dabei: Analyse und Variantenfindung zur Frage nach dem Typ des Signalverarbeitungsgeräts. Die beiden realistischen Möglichkeiten für meine Arbeit waren: SPS (Typischerweise in der Gebäudeautomation eingesetzte Geräte, speziell für Steuerung und Automatisierung von Anlagen entwickelt) oder Mikrocontroller wie Arduino (kleine Computer, die praktisch alles können, was ein "richtiger" Computer auch kann, nur halt... in "mikro") .
Aufgrund dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für eine SPS des Typs "Siemens LOGO!"

12/35
3-2: Variantenfindung 2: Signaltyp – Analog oder BUS?
Für die Signalübertragung der Messwerte von Sensoren zu einer Auswertungs- oder Verarbeitungseinheit gibt es heutzutage grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder via Analogsignal (Spannung zwischen 0-10V; Strom 4-20mA) oder über ein BUS-Protokoll (Binärsignal).
Doch welche der beiden Varianten wäre wohl sinnvoller für meine Arbeit?
Als Resultat dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für Analogsignale.
Für die Signalübertragung der Messwerte von Sensoren zu einer Auswertungs- oder Verarbeitungseinheit gibt es heutzutage grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder via Analogsignal (Spannung zwischen 0-10V; Strom 4-20mA) oder über ein BUS-Protokoll (Binärsignal).
Doch welche der beiden Varianten wäre wohl sinnvoller für meine Arbeit?
Als Resultat dieser Gegenüberstellung entschied ich mich für Analogsignale.

13/35
3-3: Anlagedisposition
Um die Geräte zur Umsetzung meiner Funktionen definieren zu können, müsste ich erst einmal wissen, wie und wo was platziert wird, da sich daraus der benötigte IP-Schutzgrad ableiten lässt.
Dazu zeichnete ich im Vision eine Anlagedisposition, in Anlehnung an die im ersten Bild dieser Galerie gezeigte Situation vor Ort.
Um die Geräte zur Umsetzung meiner Funktionen definieren zu können, müsste ich erst einmal wissen, wie und wo was platziert wird, da sich daraus der benötigte IP-Schutzgrad ableiten lässt.
Dazu zeichnete ich im Vision eine Anlagedisposition, in Anlehnung an die im ersten Bild dieser Galerie gezeigte Situation vor Ort.

14/35
3-4: Excel, Excel, Excel... #2
Aus den Resultaten der bisher in dieser Etappe ausgeführten Arbeitsschritte, erstellte ich nun die wichtigsten Engineering-Dokumente:
-Komponentenliste: Mit welchem konkreten Gerät kann ich welches Ziel / Pflicht / Anforderung umsetzen?
-Datenpunktliste: Welche Datenpunkte (Signale, welche von der SPS erfasst oder ausgegeben werden) ergeben sich aus den gewählten Komponenten? Gibt der Energiezähler etwa seinen Messwert aus oder nicht?
-IO-Liste: Welchem Signaltyp (digital oder analog, Ein- oder Ausgangssignal) entsprechen die Datenpunkte?
Aus den Resultaten der bisher in dieser Etappe ausgeführten Arbeitsschritte, erstellte ich nun die wichtigsten Engineering-Dokumente:
-Komponentenliste: Mit welchem konkreten Gerät kann ich welches Ziel / Pflicht / Anforderung umsetzen?
-Datenpunktliste: Welche Datenpunkte (Signale, welche von der SPS erfasst oder ausgegeben werden) ergeben sich aus den gewählten Komponenten? Gibt der Energiezähler etwa seinen Messwert aus oder nicht?
-IO-Liste: Welchem Signaltyp (digital oder analog, Ein- oder Ausgangssignal) entsprechen die Datenpunkte?

15/35
3-5: SPS-Konfiguration
SPS-Systeme sind i.d.R. modular aufgebaut, d.h. es gibt Module für analoge Eingangssignale, digitale Ausgangssignale, Kommunikationsmodule etc.
Hat man einmal definiert, welche Anzahl je Signaltyp man braucht, so wie ich es mit der IO-Liste getan habe, kann man daraus Anzahl und Typ der Module ableiten, was zu einem Resultat wie oben führen kann.
Die Geräte ganz links sind die "Controller", also der "Rechner". Davon habe ich zwei benötigt, da jeder einzelne nur eine bestimmte Anzahl Signale verarbeiten kann.
Es handelt sich hierbei um eine SPS des Typ "Siemens LOGO!", da diese besonders angenehm zu programmieren ist (es muss kein Code geschrieben werden).
SPS-Systeme sind i.d.R. modular aufgebaut, d.h. es gibt Module für analoge Eingangssignale, digitale Ausgangssignale, Kommunikationsmodule etc.
Hat man einmal definiert, welche Anzahl je Signaltyp man braucht, so wie ich es mit der IO-Liste getan habe, kann man daraus Anzahl und Typ der Module ableiten, was zu einem Resultat wie oben führen kann.
Die Geräte ganz links sind die "Controller", also der "Rechner". Davon habe ich zwei benötigt, da jeder einzelne nur eine bestimmte Anzahl Signale verarbeiten kann.
Es handelt sich hierbei um eine SPS des Typ "Siemens LOGO!", da diese besonders angenehm zu programmieren ist (es muss kein Code geschrieben werden).

16/35
Vierter Akt: Elektroschema
4-1: Seitenstruktur
Die nächste grosse Etappe meiner Arbeit, war die Erstellung des Elektroschema mittels CAD-Zeichnungstool "EPLAN", welches in unserer Firma für alle Schaltanlagen verwendet wird.
In einem ersten Schritt erstellte ich die Grundlegende Seitenstruktur von diesen.
4-1: Seitenstruktur
Die nächste grosse Etappe meiner Arbeit, war die Erstellung des Elektroschema mittels CAD-Zeichnungstool "EPLAN", welches in unserer Firma für alle Schaltanlagen verwendet wird.
In einem ersten Schritt erstellte ich die Grundlegende Seitenstruktur von diesen.

17/35
4-2: Stromlaufplan
Der nächste, und umfangreichste Schritt dieser Etappe, war die Erstellung des Stromlaufplans. Dabei handelt es sich um eine Darstellungsform elektrischer Schaltungen und deren Verdrahtung. Die Geräte werden mit Symbolen dargestellt, bei welchen ihre Anschlüsse eingetragen sind. Die Verbindungslinien zwischen diesen stehen für die elektrischen Verbindungen in Form von Drähten, Kabeln oder Schienen.
Der Stromlaufplan dient mir somit als Anleitung zur Verdrahtung meiner Steuerung.
Der nächste, und umfangreichste Schritt dieser Etappe, war die Erstellung des Stromlaufplans. Dabei handelt es sich um eine Darstellungsform elektrischer Schaltungen und deren Verdrahtung. Die Geräte werden mit Symbolen dargestellt, bei welchen ihre Anschlüsse eingetragen sind. Die Verbindungslinien zwischen diesen stehen für die elektrischen Verbindungen in Form von Drähten, Kabeln oder Schienen.
Der Stromlaufplan dient mir somit als Anleitung zur Verdrahtung meiner Steuerung.

18/35
4-3: Prinzipschema
Mit einem sogenannten "Prinzipschema", auch RI-Fliessschema genannt, werden die Flüssigkeitsleitungen zwischen (elektrischen) Geräten, bspw. Ventile und Hähne, dargestellt. Um später einen Demoaufbau für meine Bewässerungssteuerung realisieren zu können, erstellte ich ein solches mit den im Stromlaufplan gezeichneten Elementen.
Mit einem sogenannten "Prinzipschema", auch RI-Fliessschema genannt, werden die Flüssigkeitsleitungen zwischen (elektrischen) Geräten, bspw. Ventile und Hähne, dargestellt. Um später einen Demoaufbau für meine Bewässerungssteuerung realisieren zu können, erstellte ich ein solches mit den im Stromlaufplan gezeichneten Elementen.

19/35
Fünfter Akt: Konstruktion
5-1: Testaufbau Wetterstation
Nach Fertigstellung des Elektroschemas konnte ich mich an die physische Umsetzung meiner Steuerung machen.
Dabei wollte ich für jeden Anlageteil einen Demonstrationsaufbau realisieren, um die Funktionen der Feldgeräte testen zu können.
Die Konstruktion der Wetterstation beschränkte sich daher auf oben gezeigte Variante, mit welcher ich Funktion und Signalübertragung der Sensoren zur SPS prüfen konnte.
5-1: Testaufbau Wetterstation
Nach Fertigstellung des Elektroschemas konnte ich mich an die physische Umsetzung meiner Steuerung machen.
Dabei wollte ich für jeden Anlageteil einen Demonstrationsaufbau realisieren, um die Funktionen der Feldgeräte testen zu können.
Die Konstruktion der Wetterstation beschränkte sich daher auf oben gezeigte Variante, mit welcher ich Funktion und Signalübertragung der Sensoren zur SPS prüfen konnte.

20/35
5-2: Konstruktion Bewässerungssteuerung
Der Demoaufbau der Bewässerungssteuerung folgt der Anordnung der Komponenten, wie sie auf dem Prinzipschema auf Bild 4-3 gezeigt ist.
Pumpe und Ventile sind über transparente Schläuche verbunden, was mir eine optische Nachverfolgung des Wasserflusses ermöglichte.
Der Demoaufbau der Bewässerungssteuerung folgt der Anordnung der Komponenten, wie sie auf dem Prinzipschema auf Bild 4-3 gezeigt ist.
Pumpe und Ventile sind über transparente Schläuche verbunden, was mir eine optische Nachverfolgung des Wasserflusses ermöglichte.

21/35
5-3: Disposition SGK
Für die Erstellung der Steuerung stellte ich die Komponenten zusammen, und ordnete sie an, sodass eine Bedienung später möglichst intuitiv von der Hand gehen würde.
Für die Erstellung der Steuerung stellte ich die Komponenten zusammen, und ordnete sie an, sodass eine Bedienung später möglichst intuitiv von der Hand gehen würde.

22/35
5-4: Bearbeitung Steuerungsgehäuse mit CNC-Bearbeitungscenter
Im Rahmen meiner Arbeit durfte ich auf eine der grossen Errungenschaften der Lescom AG zurückgreifen: Ein CNC-Bearbeitungscenter, welches Löcher, Gewinde und Ausschnitte punktgenau in Steuerungsgehäuse aller Arten einarbeiten kann.
Im Rahmen meiner Arbeit durfte ich auf eine der grossen Errungenschaften der Lescom AG zurückgreifen: Ein CNC-Bearbeitungscenter, welches Löcher, Gewinde und Ausschnitte punktgenau in Steuerungsgehäuse aller Arten einarbeiten kann.

23/35
5-5: Aufbau Steuerung
Nach der Bearbeitung durch das CNC-Bearbeitungscenter bestückte und beschriftete ich das Gehäuse meiner Steuerung
Nach der Bearbeitung durch das CNC-Bearbeitungscenter bestückte und beschriftete ich das Gehäuse meiner Steuerung

24/35
5-6: Verdrahtung
Im letzten Schritt dieser Etappe erfolgte die Verdrahtung meiner Steuerung. Als gelernter Automatiker konnte ich mich hierbei richtig austoben.
Im letzten Schritt dieser Etappe erfolgte die Verdrahtung meiner Steuerung. Als gelernter Automatiker konnte ich mich hierbei richtig austoben.

25/35
Sechster Akt: Programmierung
6-1: Netzwerkkonfiguration
Aller Anfang ist... IP-Adressen vergeben.
Computer, und dazu gehört auch meine SPS, reden gerne nicht, oder nur ins Leere.
Es sei denn, man widmet seiner Netzwerkkonfiguration ein wenig Zuneigung.
Da ich zwei Controller und ein Display verbaut habe, bestand hierzu (Nachhol-)Bedarf.
Zum Glück – und das war auch ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung für dieses System – bietet die Programmieroberfläche dieser SPS ein angenehmes Tool dafür.
6-1: Netzwerkkonfiguration
Aller Anfang ist... IP-Adressen vergeben.
Computer, und dazu gehört auch meine SPS, reden gerne nicht, oder nur ins Leere.
Es sei denn, man widmet seiner Netzwerkkonfiguration ein wenig Zuneigung.
Da ich zwei Controller und ein Display verbaut habe, bestand hierzu (Nachhol-)Bedarf.
Zum Glück – und das war auch ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung für dieses System – bietet die Programmieroberfläche dieser SPS ein angenehmes Tool dafür.

26/35
6-2: Testoberfläche
Hier sehen Sie die Grundlegende Funktionsweise der Software, mit welcher die Programmierung der SPS "Siemens LOGO!" erfolgt: Die physischen Signalanschlüsse der SPS werden als Blöcke dargestellt; optisch ähnelt die resultierende Programmierung daher einem Stromlaufplan.
Was mit den Signalen geschieht, wird durch die gezogenen Verbindungen zwischen den Blöcken bestimmt.
Zu Beginn der Programmierung erstellte ich obige Testoberfläche, um prüfen zu können, ob die jeweiligen Signale am "richtigen Ort", also dem richtigen Block ankommen.
Hier sehen Sie die Grundlegende Funktionsweise der Software, mit welcher die Programmierung der SPS "Siemens LOGO!" erfolgt: Die physischen Signalanschlüsse der SPS werden als Blöcke dargestellt; optisch ähnelt die resultierende Programmierung daher einem Stromlaufplan.
Was mit den Signalen geschieht, wird durch die gezogenen Verbindungen zwischen den Blöcken bestimmt.
Zu Beginn der Programmierung erstellte ich obige Testoberfläche, um prüfen zu können, ob die jeweiligen Signale am "richtigen Ort", also dem richtigen Block ankommen.

27/35
6-3: Skalierung Signale
Dieses Bild zeigt anschaulich, wie die Signalverarbeitung mit Blöcken und Verbindungen funktioniert: Möchte ich bspw. das 0-10V Signal meines Luftfeuchtigkeitssensor in einen Wert von 0-100% Umwandeln, so muss ich dazu lediglich den Block, welcher den Signaleingang darstellt, mit einem Funktionsblock "Analogverstärker" verbinden. Letzterer verfügt dann über einstellbare Parameter, welche mir eine Skalierung des Eingangswertes ermögliche.
Den umgerechneten, also skalierten Wert, kann ich danach auf dem mit einer Verbindung zu einem Funktionsblock "Meldetext" auf dem Display anzeigen lassen.
Dieses Bild zeigt anschaulich, wie die Signalverarbeitung mit Blöcken und Verbindungen funktioniert: Möchte ich bspw. das 0-10V Signal meines Luftfeuchtigkeitssensor in einen Wert von 0-100% Umwandeln, so muss ich dazu lediglich den Block, welcher den Signaleingang darstellt, mit einem Funktionsblock "Analogverstärker" verbinden. Letzterer verfügt dann über einstellbare Parameter, welche mir eine Skalierung des Eingangswertes ermögliche.
Den umgerechneten, also skalierten Wert, kann ich danach auf dem mit einer Verbindung zu einem Funktionsblock "Meldetext" auf dem Display anzeigen lassen.

28/35
6-4: Programmierung Bewässerungssteuerung
Dieses Bild zeigt die softwaretechnische Umsetzung der Bewässerung des Gartens mit 3 Zonen, für welche jeweils die gewünschte Wassermenge eingestellt werden kann.
Die Logik dahinter entspricht dabei derselben, wie im vorherigen Bild beschrieben, nur dass hier analoge (dicke, schwarze Linien zwischen den Blöcken) und digitale Signale (dünne Linien) parallel und Gleichzeitig verarbeitet werden.
Dieses Bild zeigt die softwaretechnische Umsetzung der Bewässerung des Gartens mit 3 Zonen, für welche jeweils die gewünschte Wassermenge eingestellt werden kann.
Die Logik dahinter entspricht dabei derselben, wie im vorherigen Bild beschrieben, nur dass hier analoge (dicke, schwarze Linien zwischen den Blöcken) und digitale Signale (dünne Linien) parallel und Gleichzeitig verarbeitet werden.

29/35
Siebenter und letzter Akt: Auswertung und Reflexion
7-1: Fehleranalyse
Nach Abschluss der Programmierung, und damit der physischen Arbeiten an meiner Anlage, ging es an die Auswertung, und damit den Schlussakt dieses Projektes.
Dazu führte ich in einem ersten Schritt eine Fehleranalyse durch, d.h. eine Aufarbeitung einiger beispielhafter Fehler, welche mir während des Entstehungs- und Erarbeitungsprozesses widerfuhren.
Dieses Bild zeigt einen davon: Die Energie der Solaranlage wird über einen Wechselrichter in eine 230V-Wechselspannung, wie sie an jeder gewöhnlichen Steckdose abgegriffen werden kann, umgewandelt. Dadurch kann die Anlage ohne weitere exotische Geräte mit Solarenergie betrieben werden.
Der Haken an der Sache: Der verwendete Wechselrichter hat eine "Schuko-Steckdose", welche nicht zwischen Phase und Neutralleiter unterscheidet. Dies wurde mir bei der Umschaltung zum Verhängnis, da ich dadurch an meinem Netzteil eine Verpolung von Phase und Neutralleiter auslöste.
Die Lösung: Stecker umgekehrt einstecken.
7-1: Fehleranalyse
Nach Abschluss der Programmierung, und damit der physischen Arbeiten an meiner Anlage, ging es an die Auswertung, und damit den Schlussakt dieses Projektes.
Dazu führte ich in einem ersten Schritt eine Fehleranalyse durch, d.h. eine Aufarbeitung einiger beispielhafter Fehler, welche mir während des Entstehungs- und Erarbeitungsprozesses widerfuhren.
Dieses Bild zeigt einen davon: Die Energie der Solaranlage wird über einen Wechselrichter in eine 230V-Wechselspannung, wie sie an jeder gewöhnlichen Steckdose abgegriffen werden kann, umgewandelt. Dadurch kann die Anlage ohne weitere exotische Geräte mit Solarenergie betrieben werden.
Der Haken an der Sache: Der verwendete Wechselrichter hat eine "Schuko-Steckdose", welche nicht zwischen Phase und Neutralleiter unterscheidet. Dies wurde mir bei der Umschaltung zum Verhängnis, da ich dadurch an meinem Netzteil eine Verpolung von Phase und Neutralleiter auslöste.
Die Lösung: Stecker umgekehrt einstecken.

30/35
7-2: Auswertung Zeitplan Soll-Ist
In einem nächsten Schritt verglich ich die geschätzten, mit den effektiven Zeitaufwänden je Arbeitsschritt und bildete die Summen davon.
Fazit: Ich benötigte deutlich mehr Zeit als geplant, da sich das Projekt als viel schwieriger und aufwendiger herausstellte, als ich zu Beginn erwartet hätte.
In einem nächsten Schritt verglich ich die geschätzten, mit den effektiven Zeitaufwänden je Arbeitsschritt und bildete die Summen davon.
Fazit: Ich benötigte deutlich mehr Zeit als geplant, da sich das Projekt als viel schwieriger und aufwendiger herausstellte, als ich zu Beginn erwartet hätte.

31/35
7-3: Auswertung Pflichtenheft
Nun wertete ich die Erfüllung des Pflichtenheftes aus: Wie viele Elemente enthält dieses insgesamt, und wie viele davon wurden erfüllt?
Ein kurz und knappe Antwort auf diese Frage sehen Sie oben: Mit einer Erfüllungsquote von über 95% bin ich sicher auf einem guten Stand angekommen.
Die paar wenigen, nicht erfüllten Elemente, torpedieren denn auch nicht die Funktionsfähigkeit der Anlage. Es handelt sich dabei etwa um die Steuerung der Anlage via SMS, für welche ich zwar die physischen Voraussetzungen geschaffen (GSM-Modul montiert und installiert), aber noch nicht die Zeit für eine Implementierung auf Softwareebene hatte.
Nun wertete ich die Erfüllung des Pflichtenheftes aus: Wie viele Elemente enthält dieses insgesamt, und wie viele davon wurden erfüllt?
Ein kurz und knappe Antwort auf diese Frage sehen Sie oben: Mit einer Erfüllungsquote von über 95% bin ich sicher auf einem guten Stand angekommen.
Die paar wenigen, nicht erfüllten Elemente, torpedieren denn auch nicht die Funktionsfähigkeit der Anlage. Es handelt sich dabei etwa um die Steuerung der Anlage via SMS, für welche ich zwar die physischen Voraussetzungen geschaffen (GSM-Modul montiert und installiert), aber noch nicht die Zeit für eine Implementierung auf Softwareebene hatte.

32/35
7-4: Auswertung Zieldefinitionen
An dieser Stelle komme ich zur zweitwichtigsten Frage dieses Kapitels: Konnte ich die Ziele, die ich mir zu Beginn der Arbeit gesetzt hatte, erfüllen?
Kurz: Ja, ich denke, das darf ich so behaupten.
Durch die Unterteilung der Ziele in grundlegende, essentielle (ME-Ziele) und erweiterte, zusätzliche Funktionen (KE-Ziele), konnte ich bei der gegen Ende hin knapp werdenden Zeit zwischen "wichtigen" und "nicht ganz so wichtigen" Arbeitsschritten priorisieren.
Die Erfüllung von 100% der ME-Ziele zeigt, dass mir dies recht gut gelungen ist.
Die zu 78% erreichten KE-Ziele lassen den Schluss zu, dass die Anlage doch über einen Grossteil (auch der erweiterten) Funktionen verfügt. Die hier übrig gebliebenen 22% sind allesamt solche, die auf Softwareebene nachträglich, oder physisch mit geringem Aufwand noch implementiert werden können – etwa die beim letzten Bild bereits erwähnte Ansteuerung der Anlage via SMS-Befehle.
An dieser Stelle komme ich zur zweitwichtigsten Frage dieses Kapitels: Konnte ich die Ziele, die ich mir zu Beginn der Arbeit gesetzt hatte, erfüllen?
Kurz: Ja, ich denke, das darf ich so behaupten.
Durch die Unterteilung der Ziele in grundlegende, essentielle (ME-Ziele) und erweiterte, zusätzliche Funktionen (KE-Ziele), konnte ich bei der gegen Ende hin knapp werdenden Zeit zwischen "wichtigen" und "nicht ganz so wichtigen" Arbeitsschritten priorisieren.
Die Erfüllung von 100% der ME-Ziele zeigt, dass mir dies recht gut gelungen ist.
Die zu 78% erreichten KE-Ziele lassen den Schluss zu, dass die Anlage doch über einen Grossteil (auch der erweiterten) Funktionen verfügt. Die hier übrig gebliebenen 22% sind allesamt solche, die auf Softwareebene nachträglich, oder physisch mit geringem Aufwand noch implementiert werden können – etwa die beim letzten Bild bereits erwähnte Ansteuerung der Anlage via SMS-Befehle.

33/35
7-5: Auswertung Erfolgskriterien
Die letzte – und wohl wichtigste – Auswertung meiner Arbeit bildet jene der Erfolgskriterien. Denn, ob ein Projekt insgesamt als Erfolg gewertet werden kann hängt, nun ja, wohl eben davon ab, ob die Erfolgskriterien erfüllt wurden.
Wie im Screenshot oben zu sehen, fehlte mir hier nur ein "halbes" Erfolgskriterium zu einer vollständigen Erfüllung.
Dieses "halbe" ergibt sich aus der von mir leider etwas unglücklich gewählten Formulierung des Erfolgskriteriums:
"Der Inhaltliche und zeitliche Rahmen für die Arbeit wurde eingehalten".
Inhaltlich enthält die Arbeit alle in Richtlinien und Vorgaben geforderten Elemente, allerdings habe ich den zeitlichen Rahmen von 150-250 Stunden Arbeitsaufwand überschritten.
Diese Übertretung nahm ich allerdings auch in kauf, da ich während der Arbeit die Entscheidung getroffen habe: Lieber zu viel Zeit aufgewendet, dafür etwas qualitativ hochwertiges, fertiges abgeben, hinter dem ich mit gutem Gewissen stehen kann.
Somit darf die Arbeit insgesamt als Erfolg gewertet werden.
Die letzte – und wohl wichtigste – Auswertung meiner Arbeit bildet jene der Erfolgskriterien. Denn, ob ein Projekt insgesamt als Erfolg gewertet werden kann hängt, nun ja, wohl eben davon ab, ob die Erfolgskriterien erfüllt wurden.
Wie im Screenshot oben zu sehen, fehlte mir hier nur ein "halbes" Erfolgskriterium zu einer vollständigen Erfüllung.
Dieses "halbe" ergibt sich aus der von mir leider etwas unglücklich gewählten Formulierung des Erfolgskriteriums:
"Der Inhaltliche und zeitliche Rahmen für die Arbeit wurde eingehalten".
Inhaltlich enthält die Arbeit alle in Richtlinien und Vorgaben geforderten Elemente, allerdings habe ich den zeitlichen Rahmen von 150-250 Stunden Arbeitsaufwand überschritten.
Diese Übertretung nahm ich allerdings auch in kauf, da ich während der Arbeit die Entscheidung getroffen habe: Lieber zu viel Zeit aufgewendet, dafür etwas qualitativ hochwertiges, fertiges abgeben, hinter dem ich mit gutem Gewissen stehen kann.
Somit darf die Arbeit insgesamt als Erfolg gewertet werden.

34/35
7-6: Lessons Learned
Zum Abschluss dieser Arbeit versuchte ich einige "Lessons Learned" zu formulieren, also Dinge die ich im Rahmen dieser Arbeit gelernt habe und mitnehmen möchte.
Das wohl anschaulichste Beispiel für ein solches, sehen sie auf diesem Bild.
Ich testete die Umschaltung auf Solarenergie erst mit einer eher kleinen Batterie mit einer Kapazität von 7Ah und 12V Nennspannung.
Nach einigen erfolgreichen Testdurchläufen funktionierte die Umschaltung plötzlich nicht mehr, und ich begann mit der Fehlersuche.
Es stellte sich heraus: Wird der – im Verhältnis zur Batterie relativ grosse – Wechselrichter (600W) zugeschaltet, so wird die Spannung der Batterie ob der grossen Last "zusammengezogen".
Ist die 7Ah-Batterie auf 12V geladen, fällt ihre Spannung unter der Last des Wechselrichters auf rund 11V ab. Dabei wird der implementierte Mechanismus zur Spannungsüberwachung aktiv, welcher die Batterie aus Sicherheitsgründen von der Last trennt.
Lösung: Die im Bild gezeigte Batterie hat eine Kapazität von 18Ah; ist sie auf 12,8V geladen, fällt ihre Spannung unter Last auf nicht weniger als 12,3V – also ein deutlich geringerer Spannungsabfall als bei der "kleinen" Batterie.
Damit ist sie weit von den 11V entfernt, welchen ich als Schwellwert zur Trennung der Batterie von der Last definiert habe.
Zum Abschluss dieser Arbeit versuchte ich einige "Lessons Learned" zu formulieren, also Dinge die ich im Rahmen dieser Arbeit gelernt habe und mitnehmen möchte.
Das wohl anschaulichste Beispiel für ein solches, sehen sie auf diesem Bild.
Ich testete die Umschaltung auf Solarenergie erst mit einer eher kleinen Batterie mit einer Kapazität von 7Ah und 12V Nennspannung.
Nach einigen erfolgreichen Testdurchläufen funktionierte die Umschaltung plötzlich nicht mehr, und ich begann mit der Fehlersuche.
Es stellte sich heraus: Wird der – im Verhältnis zur Batterie relativ grosse – Wechselrichter (600W) zugeschaltet, so wird die Spannung der Batterie ob der grossen Last "zusammengezogen".
Ist die 7Ah-Batterie auf 12V geladen, fällt ihre Spannung unter der Last des Wechselrichters auf rund 11V ab. Dabei wird der implementierte Mechanismus zur Spannungsüberwachung aktiv, welcher die Batterie aus Sicherheitsgründen von der Last trennt.
Lösung: Die im Bild gezeigte Batterie hat eine Kapazität von 18Ah; ist sie auf 12,8V geladen, fällt ihre Spannung unter Last auf nicht weniger als 12,3V – also ein deutlich geringerer Spannungsabfall als bei der "kleinen" Batterie.
Damit ist sie weit von den 11V entfernt, welchen ich als Schwellwert zur Trennung der Batterie von der Last definiert habe.

35/35
7-7: Abschluss und Fazit
Damit bin ich am Ende meiner Arbeit angelangt.
Das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät in seiner fertigen Form ziert denn auch das letzte Bild dieser Galerie.
Ich konnte im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Projekt durchführen, bei dem ich planen, entwickeln, designen, zeichnen, konstruieren, programmieren und dokumentieren durfte.
Wie die Magie der Elektrotechnik zur Behebung von lange bekannten, aber nie gelösten Problem eingesetzt werden kann – konnte ich Ihnen hoffentlich mit dieser Präsentation meiner Arbeit aufzeigen.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch auf dieser Website.
Sollten Sie sich für eine detailliertere Dokumentation meiner Arbeit interessieren, so steht sie Ihnen nachfolgend als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. Ausserdem habe ich Downloadlinks zur technischen Dokumentation, bestehend aus Software und Elektroschema, unter meinem Profil am Anfang dieser Website hinterlegt.
Damit bin ich am Ende meiner Arbeit angelangt.
Das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät in seiner fertigen Form ziert denn auch das letzte Bild dieser Galerie.
Ich konnte im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Projekt durchführen, bei dem ich planen, entwickeln, designen, zeichnen, konstruieren, programmieren und dokumentieren durfte.
Wie die Magie der Elektrotechnik zur Behebung von lange bekannten, aber nie gelösten Problem eingesetzt werden kann – konnte ich Ihnen hoffentlich mit dieser Präsentation meiner Arbeit aufzeigen.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch auf dieser Website.
Sollten Sie sich für eine detailliertere Dokumentation meiner Arbeit interessieren, so steht sie Ihnen nachfolgend als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. Ausserdem habe ich Downloadlinks zur technischen Dokumentation, bestehend aus Software und Elektroschema, unter meinem Profil am Anfang dieser Website hinterlegt.



































Narziss Studer
Sport-Freak, Science-Nerd, Ziesel-Inkarnation; in seiner natürlichen Umgebung: auf Achse in den Bergen oder am Meer
E-Mail
narziss_studer@hotmail.com
Interessantes Beigemüse zur Arbeit
Falls Sie sich für die technischen Details meiner Arbeit interessieren, finden Sie in dieser Ecke das Elektroschema und die Software zu meiner Arbeit.
ART499999- Diplomarbeit Narziss Studer - Das Lebensqualitäts-Verbesserungsgerät v1_0.pdf (PDF)
Software DA V1_2.pdf (PDF)