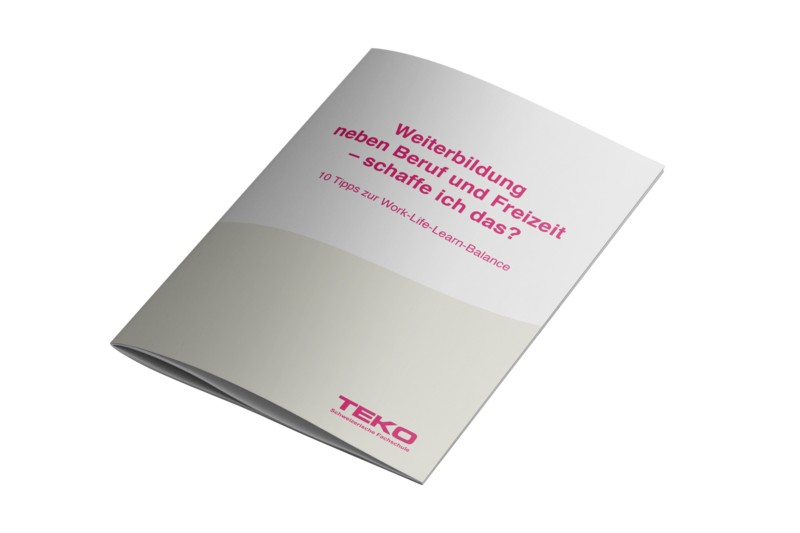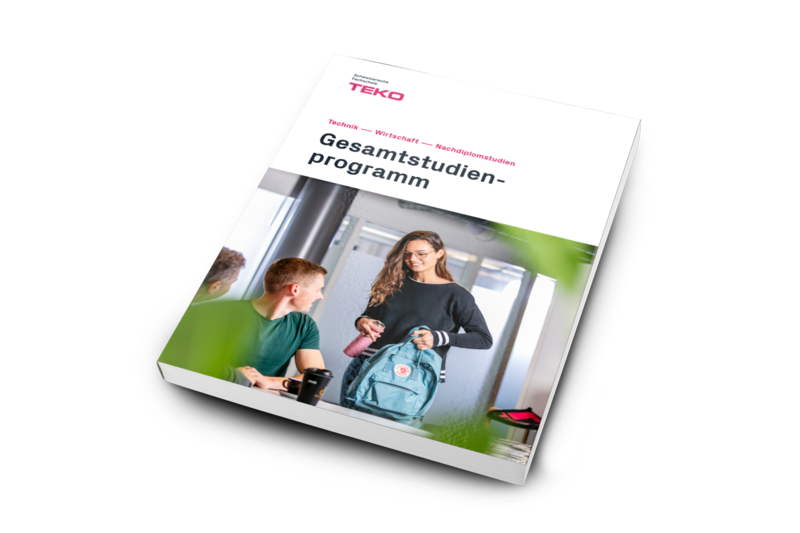100% Elektromobilität, die Welt will elektrisch werden. Nein, sie will CO2-neutral werden. Der Verbrennungsmotor, welcher uns seit Ende des 19. Jahrhunderts fortbewegt, soll durch einen klimafreundlichen Elektroantrieb ersetzt werden. Durch die Klimadebatte, die täglich geführt wird, ist ein Verbrennungsprozess, welcher die Umwelt bei jeder Umdrehung mit Schadstoffen und Feinstaub belastet, nicht weiter tragbar.
Doch was bedeutet diese Umstrukturierung? In der ganzen Debatte werden nie Daten genannt, die das Thema in seiner Grösse greifbar machen. Daher möchte ich es mir zur Aufgabe machen, dieses Thema ein wenig aufzubrechen und die Grössenordnungen aufzuzeigen, die sich darin verbergen.
Ich werde mich diversen Fragen widmen, die meiner Meinung nach entscheidende Faktoren und Grössen innerhalb dieser Umstrukturierung darstellen.
Ich werde zunächst die Ist-Situation beleuchten.
Fossile Ebene
- Aktueller Fahrzeugpark
- Km-Leistung von Herrn und Frau Schweizer
- Zusammenhänge zwischen Bevölkerungswachstum und dem Fahrzeugpark
Regenerative und nukleare Ebene
- Wieviel Strom produziert die Schweiz?
- Import/Export Bilanz
- Aktuelle Netzauslastung
Mit diesen Daten werde ich mich der Frage widmen, was es denn bräuchte, um zu einer 100%igen Elektromobilität zu kommen. Dazu müssen wir die gesamte Km-Leistung, die wir auf Basis von fossilen Brennstoffen zurücklegen, umschichten, sodass wir sie elektrisch zurücklegen können. Wir müssen uns also mit der Frage beschäftigen:
- Wie viel Energie wird dazu benötigt?
- Wieviel ist dies in der Einheit [KKW Gösgen]?
- Was braucht es, um diese Energie in das Land zu verteilen?
Mit dieser Arbeit möchte die Thematik so aufarbeiten, dass sich der Normalbürger, welcher vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich intensiver mit der Fragestellung zu befassen, eine verständliche Übersicht bekommt.
Mein Weg zum Ziel war anfangs sehr viel auf Internet Recherche und dem Umsetzen des im Studium gelernten, aufgebaut. Später wurde die Arbeit plötzlich praktisch, als es darum ging, mit Hilfe der EWK Herzogenbuchsee in einem realen Quartier aufzuzeigen, wie viel Elektromobilität möglich ist, ohne die Infrastruktur auszubauen. Dazu wurde eine Umfrage in Papierform und in einer online Version durchgeführt, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Dabei spielten beispielsweise die Anzahl Fahrzeuge, die Leistungsklassen und die möglichen Ladezeiträume eine grosse Rolle. Die Auswertung der Umfrage war schwerer als gedacht und auch zeitaufwendig. Trotzdem konnten fünf Szenarien aufgezeigt werden. Anhand des von der EWK gewählten Szenarios und den tatsächlichen Ladezeiträumen, die sich durch die Umfrage ergeben haben, konnten die erforderlichen Leistungen ermittelt werden, die zur Ladung benötigt würden. Aufgrund der realen Belastung der Transformatorstation und einem Korrekturfaktor für die Wärmepumpen, konnte der prozentuale Anteil an E-Mobilität berechnet werden, der im schlimmsten Fall (im Winter) noch möglich ist.
Eine Herausforderung, nebst der Auswertung der Umfrage, war sicherlich die Umfrage selber und auch der Rücklauf war zwar ausreichend hoch, aber nicht so hoch wie erwartet. Obwohl ich versucht habe die Grössenordnungen aufzuzeigen, bleiben viele Fragen offen, hauptsächlich die der Stromerzeugung und der Stromverteilung.
Eine Erkenntnis ist sicherlich, wie klein die Schweiz ist und was für enorme Anstrengungen noch unternommen werden müssen, um nur dieses vergleichsweise kleine Land auf Elektromobilität umzustellen. Ich glaube vielen Leuten ist es nicht bewusst, wie viel Energie tatsächlich für eine solche Umstrukturierung nötig sein wird. Ebenso wenig woher der Strom kommen soll. Mir hat die Arbeit sehr Spass gemacht, weil ich über die Ergebnisse auch immer wieder erstaunt war. Ich habe mit dieser Arbeit sicher auch gelernt, in grösseren Dimensionen zu rechnen und diese aufzuzeigen.