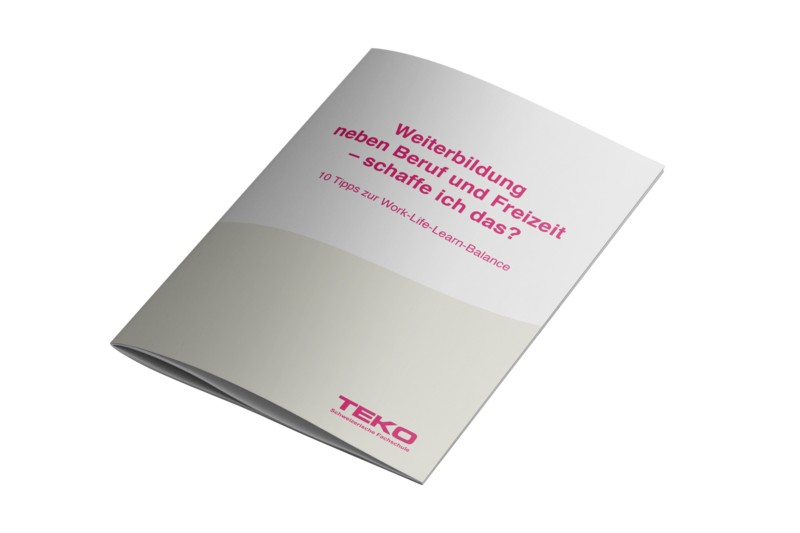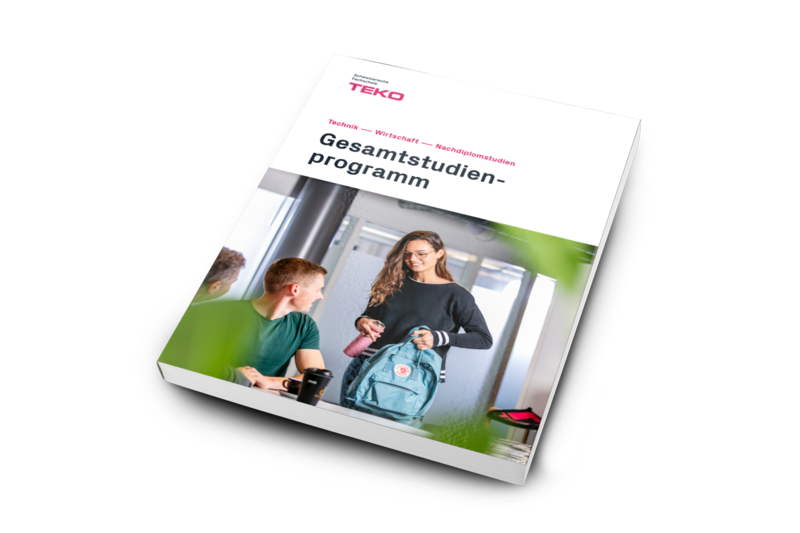Zwischen Biodiversität und Landwirtschaft bestand jahrhundertelang eine Symbiose. Die bäuerliche Landnutzung hat bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts massgeblich zu einer starken Zunahme der Artenvielfalt in der Schweiz beigetragen. Mit der «Grünen Revolution» kam es in den 1950er Jahren zu einer dramatischen Trendumkehr, seither ist die Landwirtschaft für einen nie dagewesenen Zusammenbruch der Biodiversität verantwortlich. Entscheidend dafür war die Einführung neuer Hochertragssorten bei Weizen, Mais und Reis, die deutlich höhere Erträge ermöglichten aber gleichzeitig die Verwendung grösserer Mengen Wasser, Energie, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel erforderlich machten und mit einer fortschreitenden Mechanisierung verbunden waren. Die steigenden Erträge führten zwar zu einer Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion, trugen aber auch zu einer Verschärfung sozioökonomischer Disparitäten und zu einer weiteren Verarmung der Landbevölkerung bei. Allerdings konnten sich nur die reichen Grossbauern die notwendigen Investitionen leisten. Infolgedessen nahm die relative Rückständigkeit der kapitalarmen Kleinbauern zu.
Ebenfalls einen negativen Einfluss hatte die Grüne Revolution, durch den intensiven Einsatz von
Düngemittel und Pestiziden, auf die Umwelt. Die Einbringung der giftigen Stoffe in die Landschaft hält bis heute an. Durch die Landwirtschaft gelangt jedes Jahr tonnenweise Pestizide auf den
Boden, in unsere Gewässer und früher oder später in unseren Organismus. Jedes Jahr sind es rund 2'000 Tonnen an sogenannten Fungiziden, Herbiziden und Insektiziden, die die Schweizer
Bauern über ihre Felder spritzen – über fünf Tonnen pro Tag. Diese chemischen Substanzen töten schädliche Lebewesen oder hemmen störende Pflanzen in ihrem Wachstum. Mit dem sogenannten «Pflanzenschutzmittel» sterben nicht nur die lästigen Insekten, sondern kann neben seinem Nutzen für die Landwirtschaft gleich einem ganzen Schlag von Tieren schädigen. Durch die Einbringung in den Boden landen die Pestizide in einer Drainage, in einem Fliessgewässer oder in einem See und vermischen sich zu einem Cocktail an unterschiedlichen Giftstoffen. Mehrere Studien belegen, dass auch Amphibien, Schmetterlinge, Käfer, Bestäuber wie Bienen, Vögel und einzelne Säugetiere von den Pflanzengiften betroffen sind. Diese Gifte wandern über die Nahrungskette in die Organismen der Tiere und der Menschen und sorgen für irreparable Schäden.
Diese Schäden könnten mit einer biologischen Landwirtschaft und Förderung der Biodiversität
verhindert werden. Allerdings setzen erst wenige Landwirte auf Bio, weil die Politik erst spät auf den Druck der Bevölkerung reagierten und eine Umstellung der Agrarwirtschaft mit neuen Gesetzestexten und Biodiversitätsbeiträgen unterstützen. Nicht zuletzt muss sich auch der Markt an die neuen Bedürfnisse der Produzenten und Konsumenten anpassen, damit die Landwirtschaft und die Biodiversität wieder als Symbiose funktionieren.
In der Geschichte der Schweizer Landwirtschaft herrscht ein ständiger Wandel der Agrarpolitik. Lange wird auf Tierproduktion gesetzt, doch mit dem Beginn des Krieges wird in kürzester Zeit alles zu Feldern umgepflügt und es herrscht wegen dem Zusammenbruch des internationalen Handels eine Anbauschlacht, um nicht zu verhungern. Kurz nach dem Krieg erfolgt mit der "Grünen Revolution" wieder einen dramatischen Trendumkehr, welcher für die Umwelt bis heute fatale Folgen nach sich zieht.
Um dieser Trendwende entgegen zu wirken, übernehmen wenige Pioniere die Verantwortung und rufen die biologische Landwirtschaft ins Leben. Doch der Durchbruch gelingt erst mit der Unterstützung der Gross- und Detailhändler, welche einen grossen Einfluss auf die Politik sowie auf den Markt besitzen. In den kommenden Jahren wird das Konzept von «Bio» ständig weiterentwickelt und es entstehen immer mehr Richtlinien und Vorlagen, die eingehalten werden müssen, um dem anwachsenden Interesse der Bevölkerung zu entsprechen. Mit diesem steigenden Interesse wächst auch das Bewusstsein der Folgen an der Umwelt, welche durch die intensiven Bodenbearbeitungen in der Vergangenheit entstanden sind. Dadurch erhöht sich auch der Druck der Politik und es werden Fördermassnahmen geschaffen, um die Landwirte zu unterstützen, was in der ganzen Schweiz zu einem Anstieg der Anzahl von Bio-Betrieben führt.
Durch diesen Aufschwung entstehen allerdings neue Schwierigkeiten. Einerseits wird der Markt mit Bio-Produkten überschwemmt und es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Produktion und Konsumation. Andererseits gerät mit den Fördermassnahmen das eigentliche Ziel aus den Augen und mit der zunehmenden Quantität, schwindet die Qualität der Biodiversität weiter dahin.
Mit den neuen Bio-Produkten auf dem Markt entsteht auch ein Kampf um die Preisbildung, nicht alle Konsumenten sind mit den teuren Bio-Preisen einverstanden oder können sich diese gar leisten. Eine Reduktion dieser Preise hat allerdings negative Auswirkungen für die Entlöhnung der Landwirte, welche dann ihren biologischen Betrieb nicht mehr wirtschaftlich verwalten können.
In einem Interview gewährt ein Bio-Bauer einen spannenden Einblick in das Leben eines Landwirtes, der seinen Hof auf Bio umstellen möchte und erzählt wie die Schwierigkeiten des Aufschwungs gelöst werden könnten.