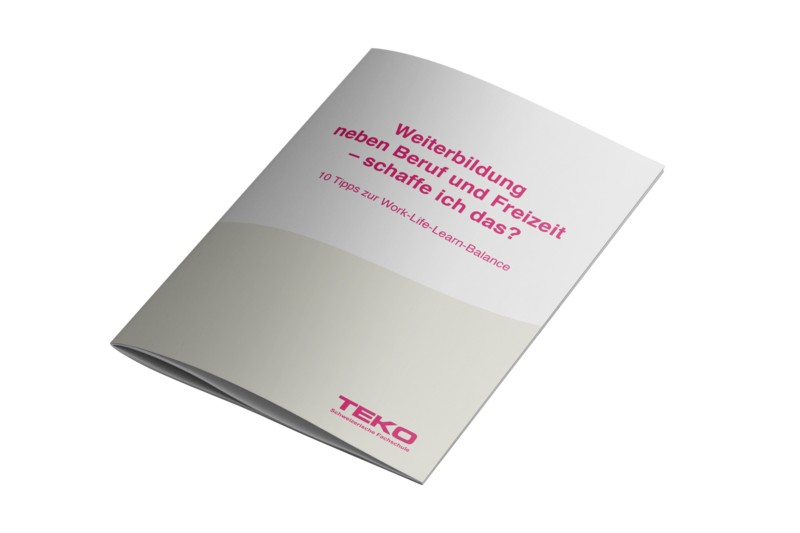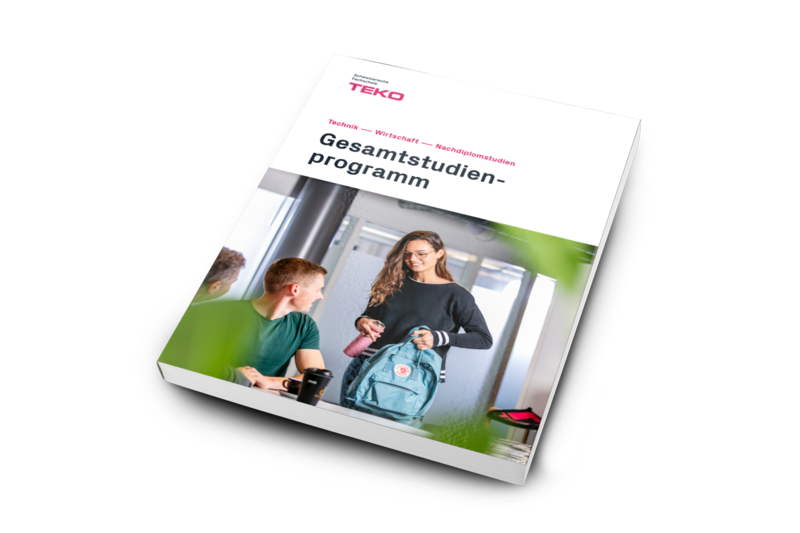Dipl. Energie- und Umwelttechniker/in HF
Kann das Lebensmittelfett aus der Schmutzwasserleitung die Strommangellage überbrücken?
Kreislaufwirtschaft auch beim Abwasser
Remo Kuster
Fette im Abwasser verursachen Probleme bei der Abwasserentsorgung. Aus diesem Grund versucht man in den meisten Ländern ein geordnetes Fettmanagement zu etablieren. In der Schweiz ist in der Liegenschaftsentwässerungsnorm SN 592'000:2024
Fettanfall ganze Schweiz
festgelegt, welche Einrichtungen Fettabscheider brauchen. Die gesetzlichen Grundlagen sind hier leider zu wenig genau und die Anforderungen für den Einbau eines Fettabscheiders sind nicht zielführend bestimmt. In der Praxis ist es jedoch häufig so, dass Fettabscheider ganz fehlen oder zu selten gewartet werden und so ihre Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Eine Möglichkeit die Situation zu verbessern, wäre die verstärkte Nutzung von Fettabscheiderinhalte als Ressource zu nutzen. Die Erzeugung erneuerbarer Energie aus Fettabscheiderinhalten ist insofern eine interessante Option, da der Anbau von Energiepflanzen in Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung steht und gezeigt werden konnte, dass die daraus erzeugte Energie eine höhere Kohlendioxidschuld hat als fossile Energieträger. Aufgrund seiner grossen Abfallmengen bieten Fettabscheiderinhalte ein grosses Biogaspotenzial. Die CO – Vergärung von Fettabfällen auf Kläranlagen steigert bis zu einer gewissen Zugabemenge den Biogasertrag deutlich, sowohl hinsichtlich der Menge als auch des Methananteil im Biogas. Die Verwertung / Entsorgung von Fettabscheiderinhalten in Faultürmen kommunaler Kläranlagen ist in der Schweiz eine gängige Praxis. Fettabfälle haben hierbei ein sehr hohes Biogaspotenzial und die Gasqualität für die Verbrennung in Blockheizkraftwerken ist durch den hohen Anteil an Methan von Vorteil. Hierbei wird meist der gesamte Inhalt der Fettabscheider (fettreiche Schwimmschicht, wässerige Phase inklusive Spülwassers, Sediment) in einem Tank gelagert und kontinuierlich dem Faulturm zuzugeben. Problematisch ist allerdings, dass der Wasseranteil in den Fettabscheidern sehr hoch ist. Diese wässerige Phase benötigt nicht nur Heizenergie während der Lagerung, sondern belegt auch den Faulraum im Reaktor. Durch Lipasen und Mikroorganismen in den Fettabscheidern kommt es zu einer Aufspaltung der Fette. Hierbei werden die Fettsäuren vom Triglycerid abgespalten und es kommt zu einer Zunahme der freien Fettsäuren. Diese Fettsäuren verursachen Schäden an den Anlagen.
Im Kanton Nidwalden werden von den 152 Betrieben, die Fett produzieren, aus den Fettabscheideranlagen total 720 m3 Fett entsorgt resp. verwertet. Werden die kantonalen Zahlen auf die Schweiz hochgerechnet, ergibt sich bei mehrmaliger Entleerung eine totale Menge von 333'879 m3 Fett. In der gesamten Schweiz gibt es 47770 Betriebe die Fett anliefern würden.
Energie aus Fett
Der aufgerechnete Wert für die ganze Schweiz ergibt 333’879 m3 Fett daraus könnten 417'349.38 m3 Gas produziert werden. Aus diesem Gas kann mit einem Blockheizkraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 40% 1 GWh Strom erzeugt werden.
Diese Strommenge wäre 1/6 der Menge, die gesamthaft mit Windkraft erzeugt wird. Mit den Stromerzeuger Solaranlagen, Atomstrom und Wasserkraft kann die Stromproduktion aus Fett, nicht verglichen werden. Bei diesen drei Stromproduzenten liegt die Strommenge extrem hoch im Vergleich zum Strom aus Lebensmittelfett.
Die Vorteile von Biogas aus ökologischer Sicht sind die Reduktion des Treibhausgases, die Verwertung von Abfällen, die nachhaltige Energiequelle, die Erzeugung von wertvollen Nebenprodukten und die dezentrale Energieversorgung. Die Herausforderungen von Biogas können die Emissionen durch den Anbau von Energiepflanzen, der Methanverlust bei der Produktion und die Effizienz im Vergleich zu anderen Energien sein.
Während einer Strommangellage kann die dezentrale Struktur der Biogasanlagen von Vorteil sein. Sie können in ländlichen Gebieten betrieben werden und reduzieren so die Abhängigkeit von zentralen Stromerzeugungsanlagen. Dies stärken die regionale Wertschöpfung und die lokale Energieautarkie. Durch die Nutzung von Abfallstoffen aus der Landwirtschaft oder der Lebensmittelindustrie tragen Biogasanlagen zudem zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei, die bei der herkömmlichen Verwertung dieser Abfälle entstehen würden. Darüber hinaus können Biogasanlagen auch mit anderen erneuerbaren Technologien kombiniert werden. Beispielsweise lässt sich überschüssiger Strom aus Wind- oder Solaranlagen zur Erzeugung von Wasserstoff nutzen, der wiederum mit CO₂ aus Biogasanlagen zu synthetischem Methan umgewandelt werden kann. Diese sogenannte Power-to-Gas-Technologie könnte langfristig zu einer vollständigen Dekarbonisierung der Stromerzeugung beitragen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter verringern. Eine der zentralen Herausforderungen ist die Skalierbarkeit. Zwar gibt es bereits zahlreiche Biogasanlagen, aber um eine flächendeckende Versorgung mit Strom aus Methan sicherzustellen, wäre ein erheblicher Ausbau erforderlich. Dies setzt umfangreiche Investitionen und politische Unterstützung voraus. Eine der größten Hürden ist die Technologie. Die Nutzung von Methan aus Fett und Öl in Biogasanlagen und Abwasserreinigungsanlagen (ARA's) bietet eine nachhaltige und effiziente Möglichkeit, zur Beseitigung der Strommangellage beizutragen. Fette und Öle haben einen hohen Energiegehalt und ermöglichen eine flexible, dezentrale Stromerzeugung, die unabhängig von Wetterbedingungen ist. Sie bietet nicht nur eine flexible und kontinuierliche Energiequelle, sondern trägt auch zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei.