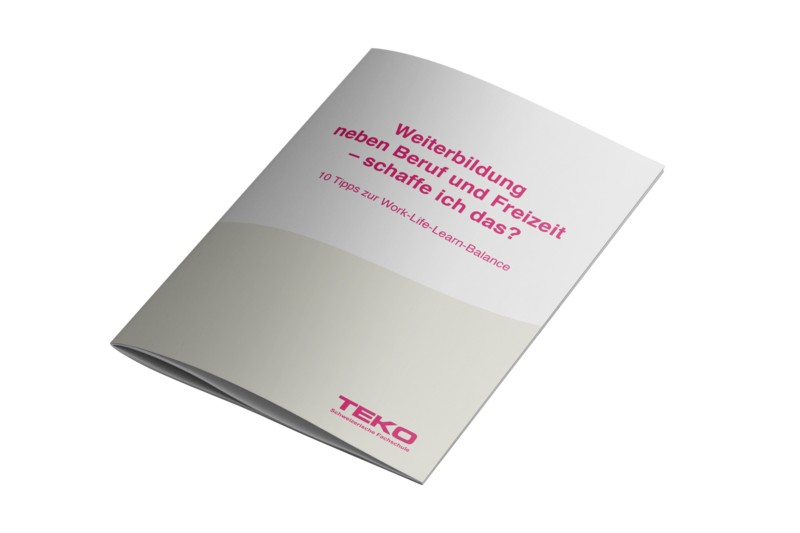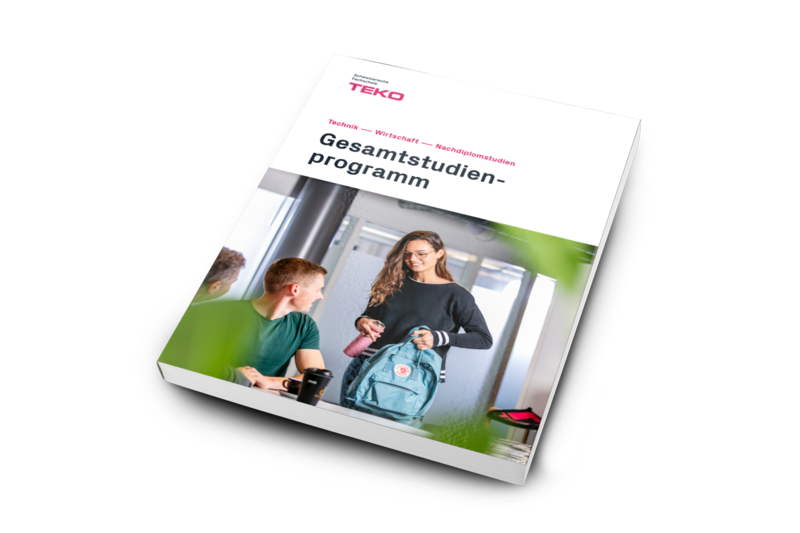Diese Arbeit teilt sich in drei Teile auf.
Speicherarten
Im ersten Teil werden die Speicher in vier Arten eingeteilt und beschrieben. Zuerst kommen die mechanischen Speicher. Sie speichern Energie durch physikalische Bewegung oder mechanische Prozesse. Ein Pumpspeicherkraftwerk, zum Beispiel, nutzt die potenzielle Energie von Masse in hohen Lagen aus. Wasser wird dabei mit überschüssiger Energie von einem tieferen Becken in ein höheres Becken gepumpt. Wird dann wieder Energie benötigt, kann man das Wasser einfach über eine Turbine zurück ins tiefere Becken ablassen. Ein Hubkraftwerk funktioniert ebenfalls mit potenzieller Energie. Aber anstatt Wasser verwendet man als Gewicht Betonblöcke oder Ähnliches. Weitere mechanische Speicher wären noch der Druckluftspeicher und der Schwungradspeicher.
Die zweite Speicherart sind die elektrochemischen, oder auch galvanischen, Zellen. Für Smartphones, E-Bikes oder auch E-Autos werden vor Allem Lithium-Akkus verwendet. Aber es gibt noch viele weitere Akku-Technologien, wie die Redox-Flow-Batterie oder die Nickel oder Blei basierenden Akkus. Superkondensatoren wurden ebenfalls in diese Kategorie genommen.
Die dritte Speicherart ist Chemisch. Dazu zählen die Power-to-Gas Technologien, bei denen man Wasserstoff, oder in einem weiteren Schritt, Methan erhält. Diese beiden Gase kann man entweder wieder Rückverstromen oder als alternative Treibstoffe einsetzen.
Als letzte Speicherart haben wir thermische Speicher. Dabei wird Wärmeenergie in einem isolierten Tank zwischengespeichert, um sie später verwenden zu können.
Zukünftige Technologien
Der zweite Abschnitt dieser Arbeit befasst sich mit zukünftigen Technologien. In der Batterieforschung werden einige Fortschritte gemacht. Zum Beispiel könnte in Zukunft die Reichweite von E-Autos mit Feststoffakkumulatoren stark erhöht werden. Neu entwickelte Salzwasserbatterien können aus weltweit verfügbaren, günstigen Materialien hergestellt werden und sind einfach zu recyclen. Im Allgemeinen ist das Recyclen oder Wiederverwenden von Akkus eine gute Idee. Viele E-Autobatterien halten viel länger als gedacht und können nach Ende der Nutzungsdauer des Autos noch als Energiespeicher zum Beispiel für Solarfarmen dienen. Eine weitere Zukunftskonzept ist das so genannte Ringspeicherkraftwerk. So können Pumpspeicherkraftwerke auch in Gebieten ohne Bergen gebaut werden.
Anlagen und Pläne in der Schweiz
Der letzte Abschnitt befasst sich mit den Anlagen und Pläne in der Schweiz. Zum Speichern von Energie haben wir in der Schweiz schon rund 100 Stauseen. Aber nur 15 davon verfügen über ein Pumpsystem, um Energie aktiv einzuspeichern. das Potenzial für Pumpspeicherkraftwerke ist aber noch nicht ganz ausgeschöpft. Durch das Abschmelzen der Gletscher werden zudem noch rund 60 weitere Standorte frei, die sich für den Bau von Stauseen oder Dämmen eigenen. Pumpspeicherkraftwerke an diesen Orten sind sehr interessant, da sie die Rolle der Gletscher übernehmen können.
Grossbatterispeicher haben wir in der Schweiz erst eines in Betrieb. Die Firma MW Storage betreibt seit Oktober 2020 ein Batterie-Energie-Speicher-System mit Lithium-Ionen Batteriemodulen in Ingenbohl. Weitere Batteriespeicher sind aber in Planung. Zum Beispiel ist die weltweit grösste Redox-Flow-Batterie in Laufenburg geplant. Der Bau soll im Sommer 2028 abgeschlossen sein.
Weiter werden noch Hubspeicher und Druckluftspeicher in der Schweiz getestet.
In Uri, in Bürglen baut man zudem noch die erste Wasserstoffproduktionsanlage der Schweiz. Sie erweitert das vorhandene Wasserkraftwerk und wird in Zukunft Autos, Lastwagen und sogar Kursschiffe mit einem klimaneutralen Treibstoff versorgen.